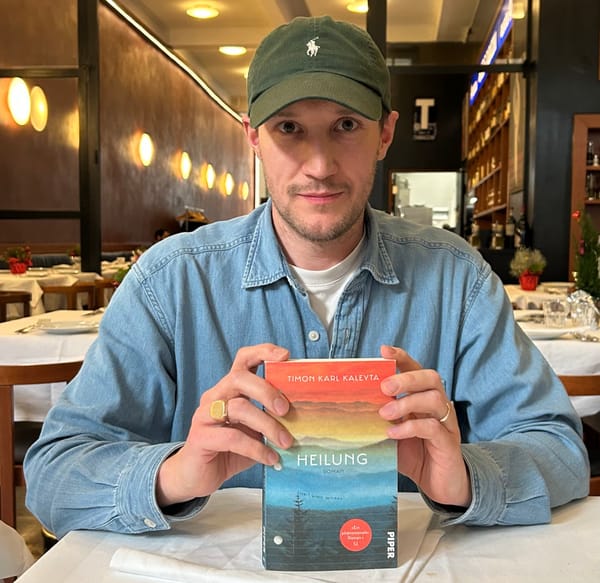Paris, Salle Gaveau, Ensemble Le Consort, IOCO

16.10.2025
Jubiläums-Konzert mit dem Ensemble Le Consort.
DAS BAROCKE EUROPA…
Strike the viol, touch the Lute;
Wake the harp, inspire the flute;
Sing your patronesse’s praise,
Sing, in cheerful and harmonious Lays.
(Henry Purcell)

Das Programm des heutigen Abends – und eigentlich die gesamte musikalische Entwicklung des Ensemble Le Consort seit seinen Anfängen – zeichnet ein weites Panorama dessen, was oft als das Barockes Europa bezeichnet wird: Eine durchaus berechtigte Formel, wenn man eine Epoche bedenkt, in der der künstlerische Austausch zwischen den Königreichen, Fürstentümern oder Stadtrepubliken des Kontinentes eine bemerkenswerte Intensität aufwies. Die Revolution des Ersten Barock entstand in Italien in den Beinhäusern des 16. Und 17. Jahrhunderts, in diesen berühmten Adelskreisen, von denen die Camarata Bardi in Florenz wohl die berühmteste war. In diesen Salons kamen Dichter und Musiker zusammen, um eine natürlichere Kunst zu erreichen als die bis dahin vorherrschenden großen polyphonen Konstruktionen. Sie experimentierten mit verschiedenen Klangformeln, aus denen sich allmählich der vom Basso continuo unterstützte Sologesang entwickelte.
Das Ergebnis dieser Unternehmungen war erstaunlich: Oper und Oratorium markierten den Übergang zur modernen Musik, die Instrumentalmusik erlebte fast unmittelbar danach einen Aufschwung und erreichte die gleiche Höhe wie die Vokalmusik. Claudio Monteverdi (1567-1643) verkörperte diese neue Kunst natürlich mit seiner berühmten Trilogie: Doch mehr als drei Jahrzehnte lagen zwischen dem erhabenen Erbe von L’Orfeo (1607) und der beispiellosen Flexibilität des Rezitativs, den melodischen Kurven von L’Incoronazione di Poppea (1642), dem ultimativen Meisterwerk des alten Maître, das die Türen zu einer neuen Ästhetik öffnete.

Die Instrumentalmusik profitierte stark von den Innovationen ihrer vokalen Schwestern und entwickelte sich sogar noch rasanter: Die Maîtres wie Biagio Marini (1594-1665), Dario Castello (1602-1631) oder insbesondere Marco Uccelini (1603-1680) verliehen ihr den Adelstitel und befreiten sie meisterhaft von der Vokalkunst. Der große italienische Geiger des frühen 17. Jahrhunderts war offensichtlich der römische Maître Arcangelo Corelli (1653-1713), einer der Väter des Concerto grosso und vor allem der Triosonate, zwei Genres, die schnell ganz Europa eroberten. Corelli, ein immenser Virtuose – seine Werke zeugen davon – unternahm es jedoch nicht, das Konzert für Solisten weiterzuentwickeln und dies fiel einem anderen Giganten der Zeit zu, diesmal einem Venezianer.

Antonio Vivaldi (1678-1741) faszinierte ganz Europa mit seinem teuflischen Geigenspiel und er komponierte Konzerte, die sein eigenes technisches Können aufs Äußerste widerspiegelten. Der „Petre rosso“ – er war Priester, übte seinen Dienst jedoch aus gesundheitlichen Gründen nie aus, zumindest der gängigen Version zufolge – widmete sich auch der Triosonate und verlieh ihr sein vulkanisches Temperament, das sich etwas von der Corelli-artigen Manier unterschied, der die aristokratischen Linien und durchsichtigen Harmonien bevorzugte. Obwohl er eifersüchtig seine Rechte und die Veröffentlichung seiner Instrumentalmusik überwachte, konnte Vivaldi es nicht versäumen sich an Opernkompositionen zu wagen, was für jeden Komponisten, der auf internationaler Ebene Anerkennung finden wollte, ein notwendiger Schritt war. Sein erstes dramatisches Werk lieferte er jedoch erst 1713, im Alter von 35 Jahren, mit Ottone in Villa, RV 729 (1713), das nicht in Venedig, sondern in Vicenza uraufgeführt wurde. Die genaue Zahl von Vivaldis Opern lässt sich nicht genau schätzen, doch sind etwa fünfzig gedruckte Librettos erhalten, was bedeuten würde, dass Vivaldi mindestens eine ähnliche Anzahl an Opern komponierte. In einem Brief gab Vivaldi die Zahl von 94 lyrischen Werken an, doch seine Neigung zur Übertreibung komplizierte die Sache. Die Oper nahm zweifellos einen zentralen Platz in seiner Karriere ein und die meisten seiner Reisen außerhalb Venedigs unternahm er, um die Entstehung seiner Opern zu überwachen.
Der Geschichte – und den Anhängern des deutschen Komponisten zufolge - verliebte Vivaldi sich in Händels Oper beim beiwohnen der Uraufführung von Agrippina, HWV 6 (1709) im Teatro San Giovanni Grisostomo. Die beiden großen Männer trafen sich wahrscheinlich bei diesem wichtigen Ereignis! Georg Friedrich Händel (1685-1759) erweist sich in den Augen der Geschichte als das größte Genie der italienischen Oper. Geboren in Sachsen, zunächst an der Hamburger Oper ausgebildet, die in den der Öffentlichkeit präsentierten Werken freudig Italienisch und Deutsch vermischte, somit blieb Händel auch von 1706 oder 1707 bis 1710 in Italien: Dort fand er die Bestätigung seiner Leidenschaft für die italienische Oper! Nachdem er sich 1712 dauerhaft in England niedergelassen hatte, versuchte er den Londonern seine Liebe aufzuzwingen und das mit einer Hartnäckigkeit, die fast drei Jahrzehnte anhalten sollte. Am Ende dieser erfolgreichen Jahre, in denen zahlreiche Meisterwerke entstanden, musste Händel sein Scheitern eingestehen: Die Launen der großen italienischen Sänger ermüdeten das Publikum, ganz zu schweigen von den finanziellen Rückschlägen, die durch die starke Konkurrenz von der Opera of the Nobility verursacht wurden. Anschließend öffnete es die Türen für das englische Oratorium – mit großem Erfolg!

Vor Händel hatte sich England bereits mit italienischer Musik beschäftigt und transalpine Künstler – vor allem Instrumentalisten – willkommen geheißen, die zur Schaffung einer originellen Ästhetik beitrugen, die die beiden nationalen Schulen miteinander verband. Dies ist der Fall des neapolitanischen Komponisten Nicola Matteis (1650-1713), eines immensen und etwas exzentrischen Geigers, der die sonnige Lyrik seines Herkunftslandes, aber auch die Ernsthaftigkeit seiner germanischen Maîtres Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) und Johann Gottfried Walther (1684-1748) einführte. Obwohl er in Brüssel geboren wurde und den größten Teil seiner Karriere in Deutschland verbrachte, blieb Giuseppe Maria dall’Abaco (1710-1805) mehrere Male in England und spielte dort – zumindest in 1736 und 1737. Er galt als der größte Cellist seiner Zeit und sein Name erscheint in Charles Burney’ (1726-1814) berühmten Tagebuch. Von seinem Vater Evariste Felice Dall‘Abaco (1675-1742), ebenfalls ein renommierter Cellist, ererbte Dall‘Abaco sowohl von Corelli als auch von Vivaldi und seine 24 Capricci N° 24 in C-Mineur, Op. 1 für Solo-Violine (1712) diesen virtuosen Stil, der auch die gesamte Rhetorik des Barock enthält.
Trotz Matteis‘ Berühmtheit war es Henry Purcell (1659-1695) Aufgabe, die englische und italienische Sensibilität zu vereinen und zusätzlich den französischen Einfluss hinzuzufügen, den König Charles II. (1630-1685) im Gepäck hatte, als er 1660 aus seinem Exil in Frankreich zurückkehrte, das ihm durch die Diktatur von Oliver Cromwell (1599-1658) und des Commonwealth aufgezwungen worden war. Purcell gehört zu den englischen Komponisten, deren Aufstieg den kometenhaftesten erlebte und der sich dank der Protektion seines älteren Kollegen und Freund John Blow (1649-1708) eine solide Position am Hof sicherte. Anschließend nahm er einen unverzichtbaren Platz in den Londoner Theatern ein, wo seine Musik, einem typisch lokalen Brauch entsprechend viele Stücke brillant begleitete. Purcell brachte das Genre der Semi-Oper zur vollen Reife, eine Mischung aus gesprochenem Drama und Musik, deren berühmteste z. B. King Arthur (1691) und The Fairy Queen (1692) sind. Zuvor hatte er sich mit der kurzen, aber äußerst ergreifenden Dido and Aeneas (1689) als Autor der ersten spezifisch englischen Oper etabliert.

Während England der italienischen Musik nur vorsichtig seine Arme öffnete, zeigte das Königreich Frankreich seinerseits offene Feindseligkeit gegenüber seinem südlichen Nachbarn. Sicherlich war die allgemeine Bewunderung für Corelli und seinem Klang – insbesondere für die Zwölf Sonaten für Violine, Op. 5 aus dem Jahr 1700 – auch in Frankreich vorhanden: Seine raffinierte Ausdruckskraft konnte ein französisches Publikum, das bescheidene Poesie liebte und italienischen Exzessen feindlich gegenüberstand, nicht verführen. Marin Marais (1656-1728) komponierte Triosonaten, während François Couperin (1668-1733) zu „vereinigten Geschmäckern“ aufrief. Im Jahr 1705 veröffentlichte Jean-François Dandrieu (1682-1738) seine Sammlung von Triosonaten, seine ersten 6 Triosonaten Op. 1 (1705), in dem genau diese Synthese erreicht wurde und das Ensemble Le Consort in den letzten Jahren zu Recht ans Licht gebracht hat.
Die ebenfalls in Italien entstandene Kantate erlebte ihren Durchbruch in F-Dur (perça) erst im 18. Jahrhundert, als sie ihren italienischen Charakter teilweise aufgab. Wie Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), verbrachte auch Michel Pignolet de Montéclair (1676-1749) vermutlich einige Zeit in Italien, befolgte jedoch eine relative musikalische Orthodoxie und verlieh seinen Kantaten die dramatischen Elemente der lyrischen Tragödie. Auch durch den Wechsel zwischen Rezitativen und Arien unterscheidet sich die Kantatille von der Kantate durch eine geringere Anzahl musikalischer Nummern. Die Kompositionen waren jedoch keineswegs weniger ausgereift: Wiederum dank dem Ensemble Le Consort kennen wir die Partituren von Louis Antoine Lefebvre (etwa 1700-1763) besser, deren sehr moderne Instrumentalverzierung ebenso glänzt wie die hervorragenden Gesangslinien…
Dieses Konzert ist eine Philippe Maillard Produktion!
Das Konzert im Rahmen des zehnjährigen Geburtstag des Ensemble Le Consort im Salle Gaveau / Paris am 16. Oktober 2025:
Zehn Jahre und auch das Versprechen von noch besseren Jahren…
Théotime Langlois de Swarte, Violine ; Sophie de Bardonnèche, Violine ; Hanna Salzenstein, Violoncello und Justin Taylor, Clavecin feierten das zehnjährige Bestehen ihres Ensemble Le Consort im Salle Gaveau. Die vier Künstler fanden sich ursprünglich für die Triosonaten des Repertoires zusammen, eine Instrumentenform, die sie auch heute Abend mehrmals aufführen werden. Alle vier Künstler haben schon eine sehr erfolgreiche Solokarriere hinter sich, wie die verschiedenen in den letzten Jahren unter ihrem Namen veröffentliche CDs belegen. Das Ensemble Le Consort erweiterte sein Repertoire und begleite auch schon mehrere Opernsänger bei Konzerten, von denen einige heute Abend hier sind. Auch zwei Musiker waren eingeladen: Louise Pierrard, Viole de gambe und Géraldine Roux, Alto.
Ein Jubiläumskonzert ist gewissermaßen eine Stilübung, spannend und gefährlich zugleich! Die Instrumentalstücke dieses Abends demonstrieren auf brillante Weise die Qualitäten jedes Solisten sowie den kollektiven Aspekt des Quartetts. Welche wunderbare Ausgewogenheit in diesen wunderschönen Triosonaten von Vivaldi und Dandrieu! Welche Freiheit in diesen Follia oder diesen Quasi-Improvisationen am Rande! Und schließlich welche Schönheit in diesen reibenden und fast dissonanten Klängen von Corelli, einem Komponisten, mit dem Le Consort zweifellos Wunder vollbringen würde.

Der Gesangspart erfordert etwas mehr Zurückhaltung, auch wenn die Großzügigkeit der anwesenden Sänger hervorgehoben werden muss, insbesondere die der leicht erkrankten französischen Mezzo-Sopranisten Eva Zaïcik, die tapfer einen unzeitigen Hustenanfall auf der Bühne ertragen hat. Zu Beginn des Konzerts scheint die Mezzo-Sopranistin von den Koloraturen und dem Wahnsinn der Dejanira aus Händels anspruchsvollem musikalischen Drama Hercules, HWV 60 (1744) ein wenig überwältigt zu sein. Andererseits verschmelzen wir mit dem bewegenden Tod der Dido aus Purcells Oper Dido and Aeneas und bewundern auch an ihrem königlichen Stil dieser lyrischen Tragödie – Stimmführung, Deklamation, Wortsinn – desgleichen auch in dem großartigen „Venez chére ombre“ von Lefebvre. Dans Vivaldi, beeindruckt die französische Mezzo-Sopranistin Adèle Charvet in „Sovvente il sole“, einem Auszug aus Andromeda liberata (1726), mit einem großartigen Dialog zwischen der Stimme und der Solo-Violine: Geschmeidiges Legato, aufrechterhaltene Linie, gerechte Ausdruckskraft. Dann legt sie in der „Alma oppressa“ aus La Fida ninfa (1732) mutig ein frenetisches Tempo an den Tag, auch auf die Gefahr hin, dabei manchmal die Klarheit der Vokalisen zu vernachlässigen. Der französische Countertenor Paul-Antoine Bénos-Djian wiederum erweist sich in Auszügen aus Purcells Sonate g-Moll, Z 807 (1697) als perfekt, darunter eine berauschende Arie: „Strike the viol“.
Lassen wir uns die Freude nicht verderben: Das Konzert endet mit einem wahrhaft festlichen Ton! Zunächst mit Monteverdis „Pur ti miro“, gesungen von allen drei Sängern: Die beiden Mezzo-Soprane und der Countertenor teilen sich auf wunderbare Weise die Zeilen von Poppea und Nerone. Dann mit dem unvermeidlichen „Tanz der Wilden“ aus Les Indes galantes (1735) von Jean-Philippe Rameau (1683-1764) und schließlich die letzte Gavotte aus Vivaldis Zwölf Triosonaten in g-Moll, RV 73 (1703 und 1705), dem emblematischen Stück des Ensemble Le Consort. Wie wünschen den Musikern, dass sie in nächsten zehn Jahren ebenso einfallsreich und inspiriert sein mögen wie in den vergangenen Jahren. Das Quartett bereitet sich zudem auf eine völlig neue Herausforderung vor: Eine erste Opernproduktion im Orchestergraben mit großem Orchester, die in einigen Wochen an der Opéra Comique stattfindet: Christoph Willibald von Glucks (1714-1787) Iphigénie en Tauride (1779).