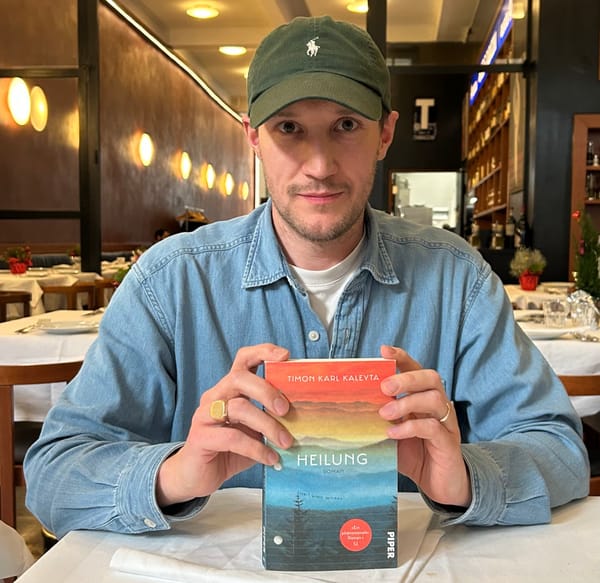Paris, Athénée-Théâtre Louis-Jouvet, Die Winterreise - F. Schubert, IOCO

19.11.2025
EINE WANDERUNG DURCH DIE NACHT…
Der Leiermann
Drüben hinterm Dorfe
Steht ein Leiermann,
und mit starren Fingern,
dreht er was er kann.
Barfuß auf dem Eise
Wankt er hin und her;
Und sein kleiner Teller
Bleibt ihm immer leer.
Wunderlicher Alter,
soll ich mit dir gehn?
Willst zu meinen Liedern
Deine Leier drehn?
(Wilhelm Müller)
Deborah Warner, eine international gefeierte britische Theater- und Opernregisseurin, hat die Grenzen des Theaters immer wieder erweitert und die Bühnensprache durch das Werk voller Energie und scharfer Intelligenz neu definiert. Für ihre Inszenierung von Franz Schuberts (1797-1828) Winterreise, D 911 (1827), seinem letzten großen Liederzyklus, befreit die Interpreten – der britischen Tenor Ian Bostridge, ein langjähriger Liebhaber des Zyklus und Autor des faszinierenden Buch Schubert’s Winter Journey: Anatomy of an Obsession (2014) und der ebenfalls britische Pianist Julius Drake, ein wichtiger Musiker der in der Montagskonzertreihe Les Lundis Musicaux des Théâtre Athénée – von den Zwängen eines traditionellen Liederabends - und eröffnet ihnen ein weitaus breiteres künstlerisches und darstellerisches Spektrum. Ein zutiefst bewegendes Werk, ein beeindruckendes Theater- und Musikerlebnis.

„…ich bin ein Fremdling überall!“
Im Oktober 1816 komponierte Schubert das Lied Der Wanderer nach einem Gedicht von Georg Philipp Schmidt von Lübeck (1766-1849), dessen Schlußvers „Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück“ zum romantischen Motto schlechthin wurde. Fünf Jahre später, im Jahre 1821, veröffentlichte Schubert dieses Lied zusammen mit dem „Morgenlied“ von Zacharias Werner (1768-1823) und „Wanderers Nachtlied“ von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) im Verlag Cappi und Diabelli als sein viertes Opus. In der Zusammenstellung der Lieder zu einer kleinen Werkgruppe hat Schubert zum ersten Mal einen Gedanken musikalisch-literarisch artikuliert, der ihn bis ans Ende seines Lebens beschäftigte und bewegte, nämlich das Wandern als Metapher menschlicher Existenz: Man könnte versucht sein, das von Schubert veröffentlichte Liederheft mit „Der Wanderer“ oder „Das Wandern“ zu überschreiben.
Schubert hat in seinem kurzen Leben eine Vielzahl von Gedichten komponiert, in denen Motive des Wanderns lyrisch zur Sprache kommen. Das hat zunächst, um es verkürzt zu sagen, Gründe der unmittelbaren Zeitgenossenschaft, denn in der literarischen Romantik des frühen 19. Jahrhunderts bildet das Wanderer-Motiv ein zentrales Thema, das die unterschiedlichsten literarischen Formulierungen und Ausdeutungen gefunden hat. Schubert kannte nicht nur die zentralen literarischen Tendenzen, die in seinem Freundeskreis ständig diskutiert wurden, in vollkommenen Einklang. Gleichwohl wäre es zu einfach und vordergründig, Schuberts Vorliebe für Wanderer-Motive ausschließlich auf sein Interesse an die romantische Literatur zurückzuführen; auch die Versuche, diese Vorliebe unter biographischen Gesichtspunkten psychologisierend zu deuten, führen über Hypothesen nicht hinaus.

Schubert hat vielmehr in seiner Musik das romantische Wanderer-Motiv zu einer unverwechselbaren musikalischen Chiffre verwandelt, in der die sprachliche Begrifflichkeit der romantischen Lyrik in einem nicht mehr zeitgebundenen Sinne aufgehoben ist. Seine Musik scheint auf eine ziellose Weise unaufhörlich fortzuschreiten; dabei bewegt sie sich in Dimensionen, die kaum noch mit den traditionellen Vorstellungen von Nähe und Ferne, von Vertrautheit und Befremden zu erfassen sind. Schuberts Wanderer-Kompositionen kulminieren, sieht man von den Instrumentalwerken ab, schließlich in den beiden Zyklen nach Gedichten von Wilhelm Müller (1794-1827) Die schöne Müllerin (1823) und Winterreise. Während die Lieder in Die schöne Müllerin insgesamt noch durch einen eher traditionellen Tonfall gekennzeichnet sind, lassen sich die Lieder der Winterreise sowohl in ihrer unverwechselbaren Einmaligkeit als auch in ihrem übergeordneten zyklischen Zusammenhang nicht mehr mit dem überkommenen Liedbegriff in Einklang bringen. Schubert selbst wusste, dass er mit den Liedern der Winterreise eine Grenze überschritten hatte, hinter die er nicht mehr zurückgehen konnte, auch wenn ihm niemand mehr folgen wollte. Über den verstörenden Eindruck, den Schuberts Lieder auf seine Freunde machte , als er sie ihnen zum ersten Mal singend und spielend vorführte, berichtet sein Freund und Förderer Joseph von Spaun (1788-1865): „Schubert wurde durch einige Zeit düsterer gestimmt und schien angegriffen. Auf meine Frage, was in ihm vorgehe, sagte er nur „nun, ihr werdet es bald hören und begreifen“. Eines Tages sagte er zu mir: „komme heute zu Franz von Schober (1796-1882 , ich werde euch einen Zyklus schauerlicher Lieder vorsingen. Ich bin begierig, was ihr dazu sagt. Sie haben mich mehr angegriffen, als dieses je bei anderen Liedern der Fall war. Er sang uns nun mit bewegter Stimme die ganze Winterreise durch. Wir waren über die düstere Stimmung dieser Lieder ganz verblüfft und Schober sagte, es habe ihm nur ein Lied, Der Lindenbaum“ gefallen. Schubert sagte hierauf nur, „mir gefallen diese Lieder mehr als alle und sie werden euch auch noch gefallen“.

Schuberts: Winterreise besteht aus einer Folge von 24 Liedern, die Schubert in zwei Abteilungen zu je 12 Liedern aufgeteilt hat. Diese Aufteilung hat nichts mit einem kompositorischen Plan zu tun, sie hat ausschließlich äußerliche Gründe. Als erstes komponierte Schubert die Lieder 1 bis 12. Er hatte die Gedichte von Müller in dieser Aufeinanderfolge in dem Almanach Urania Taschenbücher im Jahr 1823 gefunden; sie waren dort von dem Poeten unter dem Titel Wandererlieder veröffentlicht. Die Wintereise in 12 Liedern wurde veröffentlicht von Schubert, das Manuskript trägt das Datum: Im Februar 1827. Müller beließ es indessen nicht bei den 12 Gedichten; er vergrößerte den Zyklus unmittelbar nach der Veröffentlichung in der Urania um weitere 12 Gedicht, die der Vergrößerung zugrunde liegende Idee war aber einleuchtend. Aus den winterlichen Wanderer-Liedern wird gleichsam eine novellistische Erzählung in Versen, die einen Anfang und ein Ende hat. Die Wanderer-Lieder gestalten sich nun zu einer imaginären Wanderung durch die kalte Winternacht; einer Wanderung, die am Abend beginnt und am frühen Morgen in des Köhlers Haus endet, mit den Nebensonnen am Himmel und dem Leiermann draußen auf dem Eis. Müller hat, um dieses Konzept zu verwirklichen, die bereits veröffentlichen Gedichte so integriert, dass er sie in ihrer Aufeinanderfolge teilweise verändern musste. Den endgültigen Zyklus von 24 Gedichten veröffentlichte Müller im Jahre 1824 in Dessau unter dem Titel Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten. Herausgegeben von Wilhelm Müller“. Diesen Zyklus , der eine Reise durch die Nacht beschreibt, bekam Schubert erst nach der Komposition der 12 Gedichte aus der Urania zu Gesicht. Die restlichen 12 Gedichte vertonte Schubert im Spätsommer 1827; das Manuskript trägt den Vermerk: Oktober 1827. Die erste Abteilung erschien am 14. Januar 1828 bei dem Wiener Verleger Tobias Haslinger, die zweite Abteilung am 31. Dezember des gleichen Jahres. Schubert hat die Veröffentlichung der zweiten Abteilung der Winterreise nicht mehr erlebt; er war am 19. November 1828 gestorben.
Da Müller die Anordnung der Gedichte in der endgültigen Fassung ändern musste, um die imaginäre Wanderung durch die Winternacht zumindest in poetischen Andeutungen zu begründen, hat Schuberts: Winterreise scheinbar nicht die gleiche Folgerichtigkeit wie die Müller’sche Endfassung. Doch diese Differenz hat eigentlich keine große Bedeutung: Denn Schuberts Komposition repräsentiert in gleicher Weise, jedoch im Medium der Musik, eine Wanderung durch die Nacht wie die Gedichte von Müller.
Schuberts: Winterreise ist in zwei autographischen Handschriften überliefert. Die Handschrift der ersten Abteilung stellt, von zwei Ausnahmen (N° 1 und N° 8), eine erste Niederschrift dar; das Manuskript der zweiten Abteilung ist eine autographische Reinschrift. Vergleicht man die beiden Autographen mit der ersten Veröffentlichung der Winterreise, so ergeben sich erhebliche Abweichungen. Diese Abweichungen sind vor allem darauf zurückzuführen, das Schubert den ersten Teil als ein in sich geschlossenes Ganzes konzipiert hatte. Die Erweiterung des Zyklus um die 12 Lieder des zweiten Teils musste folgerichtig auch Konsequenzen für den ersten Teil haben. Die wichtigste ist wohl die Tonartänderung des letzten Liedes der ersten Abteilung „Einsamkeit“. Ursprünglich in d-Moll notiert, hat Schubert das Lied nachträglich nach h-Moll transponiert. Während ursprünglich der erste Teil gleichsam harmonisierend disponiert ist – das erste Lied beginnt in d-Moll, das letzte Lied schließt in d-Moll -, hat Schubert nachträglich den harmonisierenden Tonartbogen von d-Moll nach d-Moll nicht nur geöffnet, sondern recht eigentlich zerbrochen. Der Grund für dieses Auseinanderbrechen ist die Tonartdisposition in der zweiten Abteilung zu suchen. Auch das Schlusslied der zweiten Abteilung „Der Leiermann“ steht in der Tonart h-Moll. Beide Lieder beginnen darüber hinaus mit der leeren Quinte h-fis. Schubert setzt also den Schluss der ersten und den Schluss der zweiten Abteilung zueinander zueinander in Beziehung; damit stellt er musikalisch einen Bedeutungsbezug zwischen „Einsamkeit“ und „Der Leiermann“ her. Der endgültige Zyklus der Winterreise schließt also in einer Tonart, die weit entfernt vom d-Moll-Beginn des Anfangs ist; als ob es keine Rückkehr mehr gäbe. Sofern es aufgrund der autographischen Quellenlage zutrifft, dass Schubert in der Winterreise einen Liederzyklus komponierte, der keine Rückkehr mehr kennt, dann ist zu fragen, welchen Sinn bzw. welche Bedeutung Schubert dieser Wanderung, die kein Telos mehr zu kennen scheint, musikalisch beimisst. Um diesen Sinn sich zu vergegenwärtigen, bedarf es eines Blickes in die Komposition selbst. Das erste Lied, also der Beginn des Zyklus, ist überschrieben „Gute Nacht“. Der Wanderer – wer immer mit dieser Figur zu identifizieren ist – verlässt das Dorf seiner Geliebten und wandert ohne Ziel hinaus in die Winternacht. Das letzte Lied des Zyklus heißt „Der Leiermann“. Auf seiner Wanderung begegnet der Wanderer jenseits des Dorfes einem Bettler, der mit starren Fingern seine Leier dreht: „Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an“. Der Wanderer fragt den wunderlichen Alten: „Soll ich mit dir gehen? Willst zu meinen Liedern deine Leier drehn?“ Mit diesen beiden Fragen schließt der Gedichtzyklus. Die bittere Ironie, die in diesen Fragen liegt, hat Schubert auf erschreckende Weise musikalisiert, denn Schubert lässt in seiner Vertonung den Leiermann vom Beginn an seine Leier drehn. Noch bevor der Wanderer überhaupt seine Frage stellt, erklingt bereits während der ganzen Zeit die Drehleier. Warum also die Frage des Wanderers? Wohl deshalb, weil die Frage sinnlos ist; die Drehleier, die ein mechanisches Instrument ist, spielt immer zu.

Gleichwohl hat Schubert dennoch eine Antwort auf die beiden Fragen des Wanderers komponiert; doch diese Antwort ist von einem Fatalismus geprägt, der das sinnlose Spiel der Drehleier noch übersteigt. Die beiden letzten Töne, die der Sänger singt – es sind die Töne g und fis -, hat Schubert wie einen Schrei komponiert; doch bilden sie eine abwärts gerichtete kleine Sekunde! Bereits in der barocken Musik stellt die kleine Sekunde eine musikalische Figur dar, die Trauer und Leid zum Ausdruck bringt. Mit einer kleinen Sekunde (f-e) beginnt auch das erste Lied des Zyklus -Gute Nacht -: „Fremd bin ich eingezogen“, sind die Textworte. Mit Hilfe der Ausdrucksfigur der kleinen Sekunde stellt Schubert also einen Zusammenhang zwischen Anfang und Ende her, wobei die Schlussworte des Endes zum Schrei gesteigert sind. Damit hat Schubert zumindest musikalisch eine Antwort auf die beiden Fragen gegeben: Diese Antwort ist der Beginn des Zyklus. Das bedeutet, dass der Zyklus der Winterreise, diese Wanderung durch die kalte Nacht, ein Zyklus ohne Ende ist, ein endloser Zirkel. So ist die Winterreise recht eigentlich eine Wanderung ohne Anfang und Ende, ohne Beginn und Ziel, ohne Hoffnung und Aussicht auf ein Entkommen. Schuberts Musik ist nicht das Versprechen des darüber hinaus Eingeschriebenen, vielmehr verharrt sie sich in der Einsamkeit und Trostlosigkeit des Hier-und-Jetzt. Vielleicht können in der Kunst Einsamkeit und Trostlosigkeit zum Inbegriff des Trostes werden: Aber das zu ertragen, grenzt wohl wahrhaftig ans Menschenunmögliche!
Zur Aufführung im Athénée -Théâtre Louis -Jouvet / Paris am 19. November 2025:
Und jeder Schritt des Wandrers ist bedenklich…
Fünfundvierzig Minuten in der kalten Nacht, unter zwei Grad… Der szenische Liederabend hat noch nicht einmal begonnen, aber wir haben schon unsere eigene Winterreise unternommen, um auf jeden Fall dabei zu sein! Der rote Samt der Sitze, die Vergoldung des Athénée Théâtre Louis Jouvet und seine Heizung bieten dem Zuschauer Komfort, bevor dieser beim Anblick der Bühne begreift, dass von Wärme heute Abend keine Rede sein wird.
Zwei große, verblasste schwarze Tafeln, deren Vorderseiten mit Kreide umrandet sind, grenzen einen kahlen Raum ab, der von einigen Schneewehen gekrönt wird. Am anderen Ende, zur Gartenseite hin, sticht das ebenfalls schwarze Klavier durch seinen Lack vor einer cremefarbenen Leinwand und im Schatten einer hoch oben sitzenden Krähe hervor. Während die anderen noch ihre Plätzte einnehmen, stehen die Künstler bereits auf der Bühne, ihre Blicke müde, auf den Boden gerichtet oder nachdenklich in die Ferne gerichtet.
Die Originalität dieser Inszenierung von Schuberts: Winterreise liegt in ihrer Gestaltung. Während die Aufführung von Schuberts Zyklus angesichts der schieren Kraft seiner musikalischen Schlichtheit und seiner inhärenten suggestiven Wirkung zunächst Fragen aufwerfen mag, gelingt es Warner eine bloß künstliche Inszenierung zu überwinden. Die Regie der Schauspieler ist in ihrer Raumgestaltung beispielhaft: Mal energiegeladen, mal statisch, aber stets fließend und natürlich, ganz im Einklang mit dem Text. Einige Bühnenelemente illustrieren bestimmte Zeilen, ohne es zu übertreiben: Der Schnee und die Krähe natürlich, die Kieswege, aber auch ein grüner Kranz, der in 21. „Das Wirtshaus“ erwähnt wird, oder eine rechteckige Fläche auf dem Boden, die sich als schauriges Grab entpuppt.

Die Stärke des Abends lag vor allem in der Lichtgestaltung des französischen Lichtdesigner Jean Kalman. Ein weißes Licht in tausend Nuancen, von einem gräulichen Nebel bis zur blendenden Klarheit der Mittagssonne auf dem Schnee. Und manchmal ein Hauch von Gelb, der die Atmosphäre erwärmt, aber immer nur aus der Ferne, denn wir wissen, dass die Atmosphäre auf der Bühne eisig bleibt: Ein Leuchten in der Mitte der Mittelwand oder die „drei Sonnen“ aus 23. „Die Nebensonnen“, deren Morgenstrahlen durch riesige Fenster in der rechten Bühnenwand fallen. Ein poetisches Licht, das die Fantasie des Publikums immer wieder beflügelt, mit einigen unvergesslichen Szenen, wie dem Hell-Dunkel-Kontrast in Bostridges Gesicht, als zwischen 5. „Der Lindenbaum“ und 6. „Wasserflut“ der Schnee fällt.
Der englische Tenor, mit seinem asketischen Gesicht und den scharfen Zügen, verkörpert vom ersten Lied an einen unvergesslichen Wanderer, an dessen Ende er wütend 1. „Gute Nacht“ mit Kreide an die Wand schreibt. Neben seiner vollen Bühnenpräsenz, die ihn dazu bringt, sich gegen die Wände zu werfen oder Requisiten durch die Luft fliegen zu lassen, beweist Bostridge seine meisterhafte Diktion. Die analytische Aussprache von „Wurm“ in 10. „Rast“ lässt den Zuhörer erschaudern, bevor sein stöhnender, brennender Stich das ganze Ausmaß seines Leidens zum Ausdruck bringt.
Durch Variationen in seiner Intonation vermittelt der Sänger die Absichten seiner Figur, drückt mal deren tiefes Unbehagen aus, mal erzählt er seine eigene Geschichte mit anderen Charakteren. Mit einer Stimme, die mal rau, mal fast gesprochen, mal in der hohen Lage hager klingt, wo manche aufsteigenden Intervalle nicht ganz treffen, bietet Bostridge eine menschliche Version des Zyklus, fernab von ästhetisierten, minimalistischen Interpretationen. Dies führt zu ebenso originellen wie fesselnden Interpretationen, wie etwa 22. „Mut!“, das auf 21. „Das Wirtshaus“ folgt und von einem Betrunkenen wie ein Trinklied gesungen wird.
Am Klavier ist Drake ein Begleiter von unerschütterlicher Bescheidenheit. Diese relative Zurückhaltung schließt jedoch ein tief empfundenes Engagement nicht aus, wenn es nötig ist, wie die ergreifenden Akkorde in 8. „Rückblick“ beweisen: Sein kraftvolles Spiel verzeiht den einen oder anderen Fehltritt, insbesondere angesichts der Atmosphäre, die leicht zu tauben Fingern führen kann. Der Pianist brilliert in den reduzierten Passagen, in denen er eine faszinierende Klangkunst offenbart. So wenige Noten und doch so viel Raum wird enthüllt… Mit solch einer nuancierten Palette hat die Trostlosigkeit eine vielversprechende Zukunft vor sich.
Am Ende des Zyklus kehrt ein geheimnisvoller alter Mann interpretiert von dem äußerst sensiblen britischen Schriftsteller und manchmal auch Statisten Colin Blumenau, der schon vor Beginn der Reise anwesend war, an seinen Platzt am Bühnenrand zurück, mit demselben verschlossenen und desillusionierten Ausdruck. Ist er der „Dreh- und Leierspieler“ aus dem letzten Stück? Die Hauptfigur, deren Erinnerungen wir gehört haben? Oder ist es der Tod, der ihn geduldig erwartet?
Die Weihnachtsdekorationen auf dem Place Vendôme auf dem Rückweg werden uns nicht von diesem letzten Rätsel ablenken…