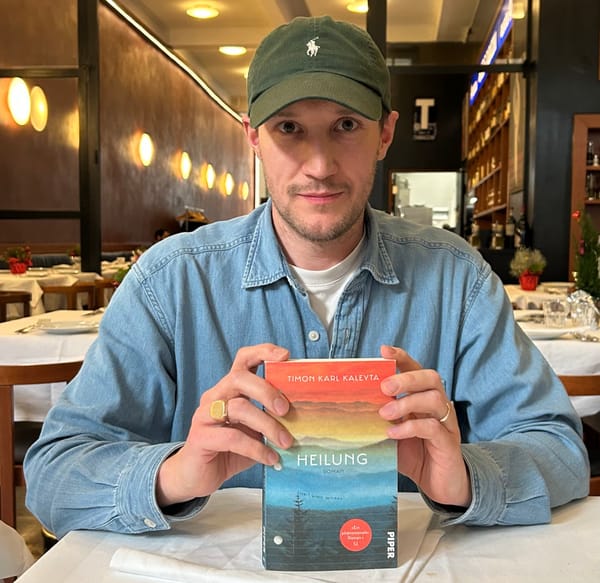Paris, Pavillon Légion d’Honneur, FESTIVAL DE SAINT-DENIS, IOCO

22.06.2025
LIEDERABEND MIT FRANZÖSISCHEN MELODIEN
Sabine Devieilhe, Sopran
Mathieu Pordoy, Klavier
Dieser intime Liederabend von großer Poesie rund um die Themen Liebe und Natur markiert die Rückkehr der französischen Koloratur-Sopranistin Sabine Devieilhe und ihrem Partner, dem französischen Pianisten Mathieu Pordoy zum Festival de Saint-Denis im näheren Umland von Paris. Eine Coproduktion mit Les grandes Voix.
MELODIES D’AMOUR…
Hôtel
Ma chambre à la forme
d’une cage
Le soleil passe son bras par
la fenêtre
Mais moi qui veux fumer
pour faire des mirages
J’allume au feu du jour ma
cigarette
Je veux pas travailler –
je veux fumer
(Francis Poulenc / Guillaume Apollinaire)
Gabriel Faurés (1845-1924) Karriere als Komponist nahm Gestalt an: Sie markierte den Abschluss der ersten Sammlung von Melodien, die 1879 fertiggestellt wurde, während die Konzerte der Société Nationale dem Musiker die Möglichkeit gaben, sich zu Gehör zu bringen. Ab 1880 entwickelte sich ein zweiter, wahrhaft spezifischer Stil, der sich sowohl von der Romantik seiner frühen Werke als auch vom konzentrierten und asketischen Stil seiner späteren Jahre unterschied. Diese neue Reife führte den Musiker 1888 dazu, sich einem Genre zu nähern, von dem er geträumt hatte: Das Theater mit einer Bühnenmusik für das Drama Caligula, Op. 52 (1888) von Alexandre Dumas père (1802-1870). Geprägt durch die Entstehung von Promethée, Op. 82 (1900) und von Pénélope (1913), war seine letzte Schaffensperiode von Taubheit überschattet, doch seine letzten Kompositionen – Melodien, Kammermusik – sind das berührende Zeichen einer inneren Musik, die völlig von seiner Zeit losgelöst ist.
„Chanson d’amour“, N° 10 nach einem Gedicht von Armand Silvestre (1837-1901) aus Poème d’un jour, Op. 21 (1878), seit 1882 lässt sich Fauré trotz eines poetischen Textes, der durch seine Bilder und seine Litanei-Struktur äußerst interessant ist, von zu viel überwältigender Sentimentalität verführen. Die berühmte Melodie „Au bord de l’eau“, N° 17 nach einem Gedicht von Sully Prudhomme (1839-1907) aus Vingt Mélodies, Op. 8 / 1er Recueil (1879) zeigt eine neue Entsprechung zwischen poetischer Sensibilität und musikalischer Sensibilität. Tatsächlich ist dieser erste große Erfolg teilweise auf die Qualitäten des Gedichts zurückzuführen: Einfachheit, flüchtige Emotion, unregelmäßige Versifikation sind den klanglichen Tugenden und der Kraft der bis dahin ausgewählten Autoren vorzuziehen. Fauré scheint sein poetisches Universum gefunden zu haben und selbst wenn Prudhomme ihm nur drei Gedichte lieferte, wird er bei seinen zukünftigen Entscheidungen diese bereits musikalische Sprache im Auge behalten. Wieder eine sehr romantische Atmosphäre, aber getrübt durch das Vorhandensein von Änderungen und fremden Noten, die die Dimension der Mehrdeutigkeit andeuten, auf der die Harmonie von Fauré basieren wird. Die Form neigt auch dazu, mit Identität und Unterschied zu spielen, wobei die drei ABC-Strophen durch wiederkehrende thematische Motive vereint werden. Aber das Bemerkenswerteste an dieser Melodie bleibt die Behandlung der Unregelmäßigkeit des Verses, die Fauré durch Dehnungssysteme oder pianistische Eingriffe in die Regelmäßigkeit zwingt. In einer wohlverdienten kurzen Pause für die Sopranistin spielt uns der begleitende Pianist mit einem hinreißenden Talent einen Ausschnitt der „Improvisation“ aus 8 Pièces bréves, Op. 84 (1869): Natürlich auch von Fauré!
Der französischste aller französischen Komponist Louis Beydts (1895-1953) schreibt seine Melodien mit einer großen Sensibilität mit einem unüberhörbaren Anklang an Fauré auf Texte von etwa zwanzig französischen Dichtern, die meisten davon aus der Gegenwart: Paul Fort (1872-1960), Paul-Jean Toulet (1867-1920), Henri de Régnier (1864-1936), Tristan Klingsor (1874-1966), usw… ohne zu vergessen Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859) oder Joachim du Bellay (1522-1560).
Zweifellos ist es Arthur Honegger (1892-1955), der diese Kunst von Beydts am besten definiert hat: „Respekt vor dem Musikstil […], das Kunstwerk, ob Symphonie oder einfache Melodie, ist ein in seiner Form und seinem Wesen streng abgegrenztes Objekt“. Aber dieser Respekt ist der Emotion, der Sensibilität und der natürlichen Eleganz untergeordnet. Obwohl Beydt von Charles Gounod (1818-1893), André Messager (1853-1929 ) und Fauré künstlerisch abstammt, ist er ein „aktueller“ Musiker: „Hören wir auf die Melodienlinien, die subtilen Modulationen, die nüchterne Verfeinerung der Harmonie“. Die Quatre Chansons pour les oiseaux (1948) nach Gedichten von Fort ist eine umwerfende Entdeckung für uns selbst und natürlich auch für das Publikum. Diese vier kleinen Geschichten sind eine Hommage an die Liebe zur Natur mit Humor und Traurigkeit. Unsere beiden Interpreten haben eine vollende und natürliche Erzählung über den Ursprung der Schöpfung gezeichnet. „Colombe poignardée“, N° 1, schmerzhaft und ausdrucksstark, „Le Petit Pigeon bleu“, N° 2, anmutig und ätherisch, „L’Oiseau bleu“, N° 3, markiert „wie in einem Traum“ eine wunderschöne lyrische Seite, die die Namen von Königinnen, Kaiserinnen und Feen auf einer schimmernden Klavierbegleitung mit chromatischem Gleiten von Akkorden auf „Liebe“ entfaltet – wie die anderen für einen hohen Sopran konzipiert, erreicht dieses sublime Gefühl seinen Höhepunkt. „Le petit Serin en cage“, N° 4, ist eine mehr als heitere und humorvolle Melodie. Während der Kater Mistigri den rohen Kanarienvogel zerbeißt – eine Imitation des Miauens der Katze ist derart natürlich, das eine wirkliche Katze sich wohl mit verkniffenen Schwanz vor lauter Angst unter das Klavier versteckt.

„Wenn man auf meinem Grabstein schreiben würde: „Hier liegt Francis Poulenc (1899-1963), der Musiker von Guillaume Apollinaire (1880-1919) und Paul Éluard (1895-1952)“, so wäre das wohl meine größter Anspruch auf Ruhm“. So drückte es der Komponist im Jahr 1945 aus, der dennoch Calligrammes, Cycle avec sept mélodies, FP 140 (1948) nach Gedichten von Apollinaire. La Fraîcheur et Feu, Cycle avec six mélodies, FP 147 (1950) nach Gedichten von Éluard, Le Traveil du peintre, Cycle avec sept mélodies, FP 161 (1956) nach Gedichten von Éluard und La Courte-Paille, Cycle avec sept mélodies, FP 178 (1960) nach Gedichten von Maurice Carême (1899-1978) noch vor sich hatte. Er liebte seine Melodien so sehr, dass er ihnen ein Journal de mes mélodies (1910-1963) widmete, in dem er gewissenhaft seine Zweifel, seine Freuden und seine Ratschläge zur Interpretation niederschrieb. Schon in sehr jungen Jahren verschlang er Poesie und schnupperte sie mit Genuss, wie er selbst sagte. Diese lange Zusammenarbeit verlieh ihm ein besonders ausgeprägtes Verständnis für zeitgenössische Poesie, insbesondere für surrealistische. „Das ist Poulenc“, schreibt Claude Rostand (1912-1970) und „an den sollten sich diejenigen wenden, die die Bedeutung der Poesie von Max Jacob (1876-1944), von Jean Cocteau (1889-1963), von Louise de Vilmorin (1902-1969) und insbesondere Apollinaire und Éluard noch nicht ganz verstanden haben. In seinen Melodien werden sie alle Geheimnisse entdecken“. Poulenc hingegen interessierte sich weniger für antike und klassische Dichter – er vertonte von diesen wohl insgesamt nicht mehr denn etwa zwanzig Stücke.
Banalités, FP 107, Cycle avec cinq mélodies, FP 107 (1940) präsentiert wohl alle Facetten von Apollinaire und Poulenc. „Hôtel“, N° 2 ist bei den normalen Klavier-Akkorden „sehr langsam und mehr als träge“ gespielt...
Diese einzigen Gedichte, die Poulenc von dem kommunistischen Dichter Louis Aragon (1897-1982) vertont hat, sind Deux Poèmes de Louis Aragon, FP 122 (1943), sie beschwören die dunklen Tage der Besatzung auf sehr unterschiedlicher Weise herauf. „C“, N° 1 hat seinen Titel von seinem einzigartigen Reim in Cé. Es erinnert an die tragische Flucht der französischen Bevölkerung vor den Nazi-Truppen und die Überquerung der Loire bei Ponts-de-Cé, in der Nähe von Angers. Der Klavierpart beginnt mit einer langen Volute in Form eines Brückenbogens und „ist aufgrund des Pedalwerks und dem zu dämpfenden Achtelnotenstapel sehr schwierig“. Diese Seite mag mit ihrer seltenen Tonart in as-Moll, ihrer hohen Lage und ihrem dunklen Charakter schwierig erscheinen, aber die Hauptsache, so der Autor weiter, sei die poetische Interpretation. Das sei das ganze Geheimnis! Es heißt, das Publikum der Brüsseler Uraufführung sei bei der vorletzten Zeile: „Ô ma France, ô ma délaissée“ aufgestanden und die durch einen herrlichen Sprung im hohen As gekennzeichnet war. „Fêtes galantes“, N° 2 macht sich auf grausame Weise über die lächerlichen Schwarzmarkt-Profiteure lustig, die sich im geschäftigen Paris ausbreiten. Eine „unglaublich schnelle Musik im Stil der „Säge“-Lieder eines Café-Konzert“ reißt den Strom dieser an „ihren Schuhen festklammernden Schwachköpfe“ mit: Die Effekte sind übertrieben und sehr komisch! Unser Pianist des Liederabends zeigt sich noch einmal als perfekter sensibler und eleganter Kavalier mit seinem Instrument, indem er eine kleine Pause für die schwerarbeitende Diva lässt: In der er eine Improvisation pour piano, N° 11, FP 113 (1941) von Poulenc mit großer Andacht und dennoch viel Witz und Humor interpretiert. Ein großer Moment in wenigen Minuten!
Wie bei Claude Debussy (1862-1918) ist die Melodie auch bei Maurice Ravel (1875-1937) kein dominierendes Genre. Wollen wir die intimste Form bestimmen, müssen wir zweifellos an die Klaviermusik denken, die an sich ein Schlüssel zur Interpretation seiner Kunst ist – zunächst durch die Werke selbst, aber auch durch den erheblichen Einfluss, den das Klavier auf den Musiker ausübte. Selbst in den Orchesterwerken des Autors von La Valse, M 72 (1920) finden wir die Spur seiner zehn Finger, die gierig Sekunden, Quinten und Viertel umschließen oder mit heimlicher Freude über die Tasten streichelt. Ravels Harmonien tragen deutlich seine eigene Handschrift! Sein Beitrag zur Wiederbelebung der Melodie ist jedoch bemerkendwert, wie Debussy und Fauré lehnte er den Belcanto ab und wandte sich gegen allzu freizügigen Gesang im italienischen oder gar germanischen Stil. Für ihn mussten musikalische Arrangements prosodische Gegebenheiten berücksichtigen und sich daher an den stilistischen Qualitäten des Textes orientieren. Debussy war von demselben Wunsch getrieben, ohne ihn jedoch durch die Wahl provokanter Gedichte – kaum poetischer Prosa, alltäglicher Themen mit wenig oder gar keiner Erhabenheit, ausländischer oder traditioneller Texte – jemals an seine Grenzen zu treiben. „Spöttisch und entschlossen“, so wie es sein Freund, der Dichter Klingsor empfindet, ist Ravel genau wie seine Musik. Ohne diesen Anflug von Humor zu vergessen, der vor allem dazu dienen sollte, eine allzu tiefe Leidenschaft zu überdecken. „Dieser ehrgeizige Traumträger schien von außen zunächst einmal beschäftigt zu sein. Es machte ihm Freude, als Dandy zu posieren. Mit der ernstesten Miene der Welt präsentierte er seine Krawatten und Socken und diskutierte ernsthaft über deren Farben“. Und Klingsor, um an die vielen Streiche der großen symbolistischen und dekadenten Dichter dieser Zeit zu erinnern, die alle den Atem anhielten und die alle vom verzauberten „Tout-Paris“ durch und durch entzaubert waren.

„Manteau de fleurs pour chant et piano, M. 39 (1903) nach einem Gedicht von Paul Gravollet (1863-1936) wurde 1905 von Julien Hamelle (1836-1917) der Musik-Editionen als neunzehnte Melodie in einer Sammlung von zweiundzwanzig Melodien für Gesang und Klavier verschiedener Komponisten mit dem Titel Les Frissons veröffentlicht: Alle nach dem gleichen Dichter! „Trois Chansons pour choeur a cappella“, M. 69 (1917) ist Ravels einzige Komposition für A-cappella-Chor, begonnen im Dezember 1914, während er sich in Paris aufhielt, um „eingegliedert zu werden“, indem er die drei Texte selbst im Geiste populärer Kinderreime verfasste. Der Text, der an die Atmosphäre der Renaissance erinnern wird von ebenso archaischer Musik mit plagalen Kadenzen und antiken Wendungen begleitet. Später wurde eine Version für eine Sopran-Stimme verfasst, die wir heute Nachmittag hören. „Vocalise-étude en forme de habanera“, M. 51 (1919) war ein Auftragswerk des Gesangsprofessors am Conservatoire de Paris, Amédée-Louis Hettich (1856-1937), der ein Repertoire an Gesangsübungen von Komponisten seiner Zeit haben wollte. Die Partitur wurde von der Alphonse Leduc (1804-1868)-Edition im Répertoire moderne de vocalises-études (1929) zusammen mit anderen Vokal-Etüden aus der Feder von Vincent d’Indy (1851-1931), Paul Dukas (1865-1935) und Reynaldo Hahn (1874-1947) veröffentlich. Hier kann unsere heutige Diva Devieilhe mit ihren ungewöhnlichen Turteltauben-Koloraturen mit dem ungehemmten Klavier miteifern! Wer wird wohl der gekrönte Sieger sein...?
Nach der Pause geht der Liebeseifer weiter…
Auch wenn die Melodien in ihrer Dauer nur einen minimalen Teil von Albert Roussels (1869-1937) Schaffen darstellen, sind sie dennoch ein höchst liebenswerter Aspekt, der sogar einen Teil des Schleiers lüften kann, mit dem der Musiker sein Werk und seine Persönlichkeit zu umgeben versucht hat. Die von diesem Mann mit großer Kultur gewählten Themen sind in dieser Hinsicht bedeutsam. Es wäre zunächst das eines „Anderswo“ – im Raum mit den sechs chinesischen Gedichten aufgeteilt in Op. 12 (1907/1908), Op. 35 (1927) und Op. 47 (1932) oder den angelsächsischen Texten, aber auch in der Zeit zurückgehend auf die Renaissance von Pierre de Ronsard (1524-1585) und ihre antiken Vorbilder Griechenlands -, ein „Anderswo“, das Distanzen zwischen dem Gelebten schafft und die Intimität des Komponisten bewahrt. Aber es gibt auch den Bereich der Natur und des Liebesgefühls – enttäuschte oder unmögliche Lieben -, in dem sich der Musiker trotz der Zurückhaltung von Ironie oder Bescheidenheit am direktesten ausdrückt.
„Le Jardin mouillé“ aus Quatre Poème, Op.3, L.3 sur le Poèmes de Régnier (1903). Die klangliche Einheit, die auch die Monotonie im Herzen des Dichters ist, wird durch ein Kontinuum von staccato-Sech-zehnteln und den winzigen Wassertropfen eines unaufhörlichen kleinen Regens gewährleistet, regelmäßig unterbrochen von hohlen Quarten und Quinten. Wir kommen nicht umhin, an „Jardins sous la pluie“ aus Estampes, Triptyque pour piano, L. 108 (1903) von Debussy desselben Jahres oder das „Jeux d’eau“ pour Piano, O. 30, (1901) von Ravel zweier vorangegangenen Jahre zu denken. „Réponse d’une épouse sage“ aus Deux Poèmes chinois, Op. 35, L. 43 (1927) von Li-Ho ( 790 – 816 nach J. C.) und Zhang-Ji (766 - 830 nach J. C.) übersetzt ins französische von Henri-Pierre Roché (1879-1959). Es ist zweifellos Roussels melodisches Meisterwerk. Eine tugendhafte junge Frau muss den Mandarin zurückweisen, der sie verführen will und den sie hätte lieben können. Gesangslinie von perfekter Plastizität, die sich über die Schlüsselwörter hinaus verlängert und in eine sinnliche Vokalisierung übergeht, die zeitweise in parlando übergeht: Keine Wirkung, aber absolute Genauigkeit des Ausdrucks. In Anlehnung an die karnatischen Tonarten Indiens, manchmal bimodal wie in der vorherrschenden Melodie, wirft der Satz überraschendes Licht. Zu diesen Dissonanzen fügt der regelmäßige Schwung seinen zarten Schwindel hinzu. In seiner überwältigenden Einfachheit, seiner verschleierten Bescheidenheit bringt der letzte Satz, „Dich nicht früher gekannt zu haben“, das ursprüngliche Motiv zurück, diese intime Landschaft mit einer uneingestandenen Verzweiflung zu beenden.
Obwohl in geringer Zahl, aber von seltener formaler Perfektion, markieren diese Melodien durch ihre Originalität ein Datum in der Geschichte des Genres. Maurice Delages (1879-1961) Musik ist in Ton und Harmonie äußerst raffiniert. In der musikalischen Bewegung von Ravel verbunden – dessen Deux Épigrammes de Clément Marot pour chant et piano (1496-1544/1900) er orchestrierte, verwendet er Änderungen und hinzugefügte Noten und entwirft eine ganz neue, erweiterte Tonalität. Das Spiel der Klangfarben verstärkt die Dissonanz und lockert die Sequenzen auf. Einige Untersuchungen zu Stimm-Effekten tragen dazu bei, diesen zu Unrecht vergessenen Musiker in den Schöpfungen der Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu ignorieren.
Quatre Poèmes hindous, Op. 3, pour Sopran et Ensemble de Musique de chambre (1914) nach Gedichten von Bhatrhari und Heinrich Heine (1797-1856). „Madras“, N° 1 - „Une belle à la taille svelte…“ mit Strophen von Bhatrhari, evoziert das unwirkliche Bild einer jungen Frau mit goldenen Schleiern. Das kaum ausgehaltene Flötenmotiv, gefolgt von der Oboe, vermittelt einen zeitlosen Aspekt. „Lahore“, N° 2 – Nach einer anonymen Adaptation eines Gedichts von Heine, kreiert eine subtile Metapher über Tanne und Palme und bringt den Begriff der Sehnsucht ins Spiel. Ein langer monophoner Gesang, begleitet von ineinandergreifenden Streichern, sorgt für mystische Geheimnisse. Das Stück endet mit geschlossenem Mund, der den Traum widerspiegelt. „Bénarès“ N° 3 – Basierend auf einem anonymen Text, beschwört es die Geburt Buddhas herauf. In sanften Nuancen und der unwirklichen Atmosphäre der harmonischen Streicher erscheint der Gott auf Erden. „Jeypur“ N°4 – In den Strophen von Bhatrhari gesteht die Liebe und ihre Qualen: „Comment peut-on l’appeler Bien-Aimée? Comment peut-on l’appeler Bien-Aimée?“ Das Flötenmotiv spielt wie in N° 1, während Klangfülle und Streicher und harmonische Streicher an N° 3.
Die Idee, diese Texte auszuwählen, kam Delage während einer Indienreise. Sie stammen aus verschiedenen Quellen, von denen zwei von dem indisch-hinduistischen Sprachphilosophen Bhatrhari (etwa 5. Jahrhundert n. J. C.) entlehnt sind und beschreiben Landschaften, ohne in ein Lokalkolorit zu verfallen. Jede Melodie ist mit einem Stadtnamen versehen, der ihr ein gewisses Geheimnis verleiht. Diese Seiten wurden 1912/13 für Sopranstimme, Streichquartett, fünf Blasinstrumente und Klavier geschrieben. Unsere Version des heutigen Abends ist eine Adaptation für Piano! Sie verdienen einen Vergleich mit den melodischen Meisterwerken der gleichen Jahre, Arnold Schönberg (1874-1951), Igor Strawinsky (1882-1971), Debussy und Ravel. Ausdrückliche Widmungen an Ravel (N° 1) oder Strawinsky (N° 4) bestätigen die Stellung dieses sehr interessanten und sehr neuen Zyklus im zeitgenössischen Schaffen. Die erste öffentliche Interpretation fand während eines SMI-Konzerts statt, bei dem unter anderem auch die Trois Poésies de la lyrique japonaise (1914) von Strawinsky – die erste Aufführung war Delage gewidmet – und die Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé, M. 64 (1842-1898/1914) von Ravel mit sehr ähnlicher Ästhetik aufgeführt wurden.
Ariettes oubliées, L. 63a, Cycle de Six Mélodies sur des Poèmes de Paul Verlaine (1844-1896 / 1903) Diese Sammlung von sechs Melodien zu Gedichten von Verlaine markiert Debussys Emanzipation von den eleganten Zwängen der frühen Melodie. Zwar finden sich noch Spuren von Klischees oder übernommenen Stilmerkmalen, doch eine authentische Reflexion über die Probleme der Vertonung setzt sich durch und kündigt insbesondere mit Spleen, N° 6 die Opéra Pelléas et Mélisande (1902) den zukünftigen Stil an, der eine dehnbare, an der Sprache orientierte Erzählung mit lyrischen Episoden aus „schönen Melodien“ abwechselt. Verlaine ist der große Favorit dieser Zeit für die Musiker: Fauré entdeckt ihn mit Clair de Lune, Op. 46, deux mélodies sur de Poémes de Verlaine (1887), bevor er ihn ausschließlich in Mélodies de Venise, Op. 58, Cycle de cinq mélodies sur le Poèmes de Verlaine (1890) übt, genau wie Debussy es in den Sammlungen von Ariettes oubliées und die Fêtes galantes, L. 86 et L. 114, Cycle de trois mélodies sur de Poèmes de Verlaine (1904) tun wird. In der Zwischenzeit wird er zugeben, Charles Baudelaire (1821-186) zu bevorzugen, aber er wird zum fließenden Stil, den unregelmäßigen Formen und den Halbtönen des musikalisch spielbaren Verlaine zurückkehren, die in ihm spezifische musikalische Reaktionen hervorrufen können. Tatsächlich scheinen hier alle alten Gewogenheiten zu erscheinen: Die wechselseitigen Rollen von Gesang und Begleitung werden vielfältiger, die Deklamation entwickelt sich vom rezitativischen recto tono zu „Gesangswendungen“, Harmonie und Form werden verfeinert. Doch, so Charles Koechlin (1867-1950): „Bleibt das Ganze trotz seiner verschiedenen Aspekte homogen. Die Interpreten werden von dieser Formenvielfalt beunruhigt sein. Aber es ist musikalisch logisch und entspricht der Idee“. Stefan Jarociński (1912-1980) betont auch die Einheit von Text und Musik, die er für völlig neuartig hält. Diese Wahl und dieses Bewusstsein für das musikalische Potenzial eines Textes bleiben unschätzbare Eigenschaften des Komponisten. In seinem Werk gibt es keine Fehler oder Irrtümer und der poetische Sinn, sehr nachdenklich, wird manchmal von besonderen Verfeinerungen begleitet, wie in die Ariettes, der die Persönlichkeiten von Charles-Simon Favart (1710-1792), Arthur Rimbaud (1854-1891), Savinien de Bergerac (1619-1655) und Victor Hugo (1802-1885) erscheinen.
„C’est l’extase langoureuse, N° 1: Es entfaltet sich in drei freien Strophen und einem Nachspiel und wechselt zwischen lyrischer Deklamation und Erzählung im recto-tono. Das „Quasi-Parlando“ bestimmter Passagen, dieses leidenschaftliche Verhör, antwortet auf das verliebte Subjekt, während andere figurativen Motive die Bilder des Textes unterstreichen: Das dumpfe Rollen der Kieselsteine – Chromatik und wirbelnde Motive -, die schlummernde Klage – zwei hartnäckige Töne.
„Il pleure dans mon cœur,“ N° 2: Es ist mäßig lebhaft, traurig und monoton, spielt mit der obsessiven Regelmäßigkeit eines Sechzehntelnoten-Motivs in der rechten Hand des Klaviers com sordini und einer Melodie in gleich großen Viertelnoten, ein müdes Zeichen der allgegenwärtigen Melancholie. „Deux élans sur Quoi! Nulle trahison? Ce deuil est sans raison“ und „Mon coeur a tant de peine“, modifizieren diese rhythmische Anordnung, während das Nachspiel perdendosi, tatsächlich Mysterium erzeugt, ähnlich wie die erste Melodie.
„L’ombre des arbres“, N° 3: Hier verwendet der Komponist das gleiche dolcissimo e morendo – Klavierschluss-Muster und betont den traurigen und melancholischen Charakter des Gedichts durch harmonische Mittel. Zum ersten Mal versucht Debussy, den „Ton zu übertönen“.
„Chevaux de bois“, N° 4: Fröhlich und klangvoll, voller Humor, erinnert es an die Atmosphäre eines Jahrmarkts im Rondo-Muster. Die Feier klingt allmählich ab und Stille – oder der Raum der Träume? – setzt ein. Klaviertriller, zitternde Akzentuierungen und Stimmtriller erzeugen Effekte, ebenso wie die vier Wiederkehrer des Haupt-Refrains-Themas, das in seinem Wirbeln schwindelerregend ist.
„Green“, N° 5: Fröhlich belebt, lässt es die verträumte Atmosphäre der ersten Seiten wieder aufleben. Der Schwung des 6/8-Takts und die melodischen Motive, die ABC-Form, die Präsenz der fließenden Triolen in der Mitte der Achtelnoten vermitteln einen Eindruck von Sanftheit und Zärtlichkeit. Ein kleines Zeichen von Jules Massenet (1842-1912) in „Rêve des chers instants qui la délasseront“ was uns in diesem ersten Heft kaum überrascht, ist die fortgeschrittenste Melodie der Sammlung.
„Spleen“, N° 6: Die Harmonik wird durch zahlreiche modale und pentatonische Akzente verkompliziert und setzt ihre große Eroberung der Chromatik und alterierter Akkorde fort. Die ausdrucksstarken Modulationen unterstreichen bestimmte Passagen voller Emotionen „Le ciel était trop bleu“. Die Intensität der Verzweiflung spiegelt sich in der hohen Lage, den herzzerreißenden Harmonien und den zahleichen Bewegungsangaben wider und verleiht viel Intensität. Für Koechlin „war vielleicht nur Debussy in der Lage, mit dieser Intensität der Verzweiflung und Liebe, unendliches Bedauern auszudrücken“.

Zum französischen Liederabend in der Légion d’honneur / Pavillon am 22. Juni 2025:
Eine Hymne an die Liebe…
Vor einem vollen Saal, das ihrem Ruf vorauseilte und das von dem Moment an, als sie die Bühne betrat auch einen enormen Applaus erhielt, lieferte Devieilhe einen Liederabend von außergewöhnlicher Qualität in Präsentation und Interpretation.
Die Sängerin betritt rennend und hüpfend wie ein Kind auf die Bühne und zieht dabei ihren begleitenden Pianisten an der Hand hinter sich her. Sie scheint es kaum erwarten zu können um zu singen. Wir sehen sie völlig ausgelassen und fröhlich: Fast unbeschwert! Doch schon bei den ersten Tönen von Faurés „Chanson d’Amour“ erstaunen wir über die große Hingabe der Sopranistin an der grandiosen Interpretation ihres göttlichen Gesanges. Extrem konzentriert, ist jedes Wort mit tiefem künstlerischem Engagement für Artikulation, Bedeutung und Intention durchdacht. Von Anfang an zieht sie uns in ihren Diskurs hinein. Nicht durch das Wort selbst, sondern durch die musikalische Intention, die die französische Sängerin diesem Wort, dieser Phrase, diesem Gedicht verleiht. In diesen wenigen Minuten inspirierten Gesangs offenbart sich die ganze Kunst von Devieilhe. Ihr Legato, ihre Klangpräzision, ihre Gesangslinie – alles an ihr trägt dazu bei, dem Text die Farben, die Stimmungen und die Dramatik des Gedichts zu verleihen. Kaum war der letzte Ton dieser Melodie verklungen, brach das Publikum in einstimmigen tosenden Applaus aus.
Nach ein paar Worten der Sopranistin, die die Reaktion des Publikums als Beweis für die „Kraft der Stimme“ hervorhebt, entfaltet sich ein höchst ungewöhnliches Konzert. Traditionell wählt ein Sänger Melodien eines Komponisten aus, die er in Zyklen unterschiedlicher Länge vorträgt. Erst am Ende dieser Übung applaudiert das Publikum! Der Künstler und sein Begleiter verlassen dann für einige Augenblicke die Bühne und kehren dann zurück, um einen neuen Melodienzyklus zu beginnen. Und so weiter! Nichts dergleichen bei Devieilhe! Sobald eine Melodie endet, wendet sie sich ihrem Pianisten zu, der innerhalb weniger Sekunden und mit diskreten Akzenten die nächste Melodie einleitet, die die Sopranistin singt, fast so, als wäre es eine weitere Strophe der vorherigen Melodie. So entsteht eine Kontinuität des Tons, die wie eine Reihe von Gemälden in verschiedenen Farben zu einem einzigen Expositionsthema wirkt. In diesem kleinen Spiel sind die Sopranistin und ihr begleitender Pianist perfekt.

So illustriert der erste Teil des Abends überwiegend die Liebe zur unvergänglichen aber „kranken“ Natur mit ihren Träumen in nächtlicher Angst der Abwesenheit mit der bezaubernden Melodie vom Anfang des letzten Jahrhunderts „Le petit serin en cage“ von Beydts, die dem großartigen dekadenten schwülstigen „Hôtel“ von Poulenc vorausgeht, das Devieilhe mit einem ermüdenden und verträumten Humor in hohen Pianissimo beendet. Dann, nach einem schon längst vergessenen „Manteau de Fleurs“ von Ravel, kehrt Poulenc mit der äußerst anklagenden Parole von Aragon an die Nazi-Besatzung von „Gestern“ mit der Melodie „C“ zurück. Äußerst kämpferisch und patriotisch von der Sängerin interpretiert! Nach der Pause findet Devieilhe mit einem Anflug von unbeschreiblichem Pianissimo zu „Le Jardin mouillé“ von Roussel, der wie ein verträumtes Souvenir an die schon längst vergessene Jugendzeit erinnert. Mit einer sehr inspirierter zarten Improvisation von Poulenc beendet Pordoy diesen Teil in einem Saal, der sich langsam bis zur völligen Schwärze verdunkelt, um die Atmosphäre, die diese beiden Künstler hinterlassen haben: Bis ins kleinste Detail auszukosten!
Nach der Pause näherte sich die Sopranistin mit äußerster Zartheit zu einem von Roussel vertonten chinesischen Gedicht in der Übersetzung von Roché „Réponse d’une épouse sage“ und bot damit einen der schönsten Momente des Abends. Devieilhe nähert sich der französischen Melodie mit einer respektvollen Reinheit, die sehr berührend ist. Ein weiterer Moment der Anmut sind die „Quatre poèmes hindous“ von Delage, gesungen mit berührender Einfachheit. Diese von Indien inspirierten Melodien haben einen Hauch von Vornehmheit und Raffinesse, wie ein Gebet an Buddha ohne jegliche Religiosität, das einen sehr persönlichen Einblick in eine Melodie voller Bezüge bietet, das man für unübertroffen halten könnte.

Konnten wir in den traumhaften „Ariettes oubliées“ von Debussy diese einmalige außergewöhnliche Gesangstechnik von Devieilhe würdigen, so hätten wir uns, auch wenn das gesamte Konzert in seiner Strenge, Genauigkeit, Konstruktion und Interpretation vorbildlich bleibt, dennoch einen gewissen „Wahnsinn“ in diesem anderthalbstündigen Melodien-Abend gewünscht. Die Sopranistin beherrscht ihr Instrument und ihren Gesang so perfekt, dass wir den Eindruck haben, in fast jeder ihrer Melodien die gleiche Intonation zu hören. Kurzum, die gesangliche Interpretation ist so wie „vom Hocker fallen“, aber nach dem Fall wünscht man sich noch viel mehr Verrücktheit, Dekadenz, Humor und etwas mehr „zwischen den Zeilen“ zu singen.
Der Pianist Pordoy, ein herausragender Architekt des wohlverdienten Erfolgs dieses Konzert, ist ein hervorragender Komplize dieses abendfüllenden und überreichen Melodien-Abends. Darunter auch mit zwei verhältnismäßig wenig oder überhaupt nicht bekannten Komponisten und auch selten interpretierten Melodien. Schon dafür alleine lohnte sich der Besuch! „Brava! Bravo! Bravi!“ Das Publikum des Pavillon der Légion d’honneur im Rahmen des jährlichen Festival de Saint-Denis entdeckte mit viel Freude einen wunderschönen Musik-Abend und applaudierte natürlich minutenlang…
… zur Freude der vielen Musik-Liebhaber gaben die Künstler noch drei Zugaben: Debussy: „Nuit d’étoiles“, L 2, sur un Poème de Théodore de Banville (1880/1823-1891). * Kurt Weill (1900-1950): Youkali, Tango Habanera (1946) Chansontext von Roger Fernay (1905-1983) aus dem Theaterstück Marie Galante (1931/34) von Jacques Deval (1890-1972). * „Le poulailler ‘Cock-a-Doo-Deldo“, Chansons aus der Folie musicale Schnock ou l’Ecole du bonheur (1952) von Guy Lafarge (1904-1990) mit einem Libretto von Marc-Cab (1900-1978) und Jean Rigaux (1909-1991). (PMP/02.07.2025)