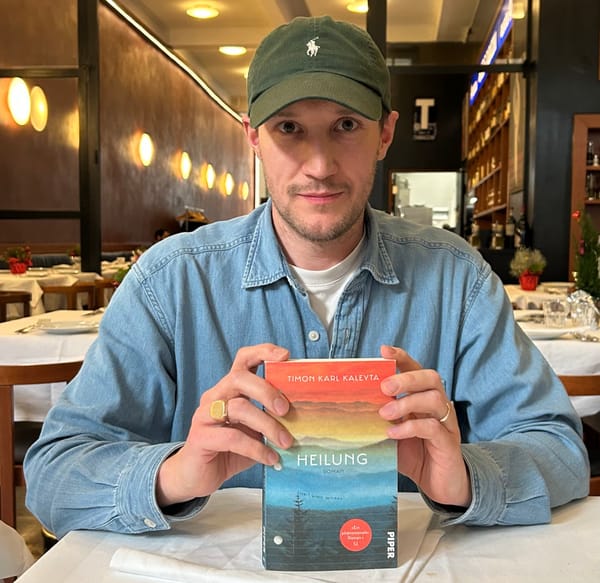Luzern, Kultur- und Kongresszentrum, Luzern Festival, Mitsuko Uchida, IOCO

07.09.2025
FREIHEIT UND WEITERGEHEN…
Klassisch oder Romantisch…?
Der Komponist Ludwig van Beethoven (1770-1877) ist weder das eine noch das andere, er steht am Scheideweg! Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass in der Person von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), der letzte Hofmusiker der den letzten Tritt eines Meisters an seinen Lakaien erhielt. Beethoven hingegen trägt kein Hofkostüm und auch seine Musik nicht! Er schreibt immer weniger für andere, im Laufe der Jahre wird er nur noch für sich selbst und gegen die Zeit schreiben: Von ihm stammt die Kluft, die wir üblicherweise zwischen einem Künstler und seinem Publikum beobachten. „Ihnen wird es eines Tages gefallen“, kennen wir nicht dieses verächtliche Wort, das halbherzig ausgesprochen wurde.
Doch Beethoven wurde nicht nur durch die Französische Revolution geboren! Eine weitere Revolution begünstigte ihn, die das Cembalo durch das Klavier verdrängte – die Tatsache, dass seine Sonaten bis zur Klavier-Sonate N° 14 in cis-Moll, Op. 27, N° 2 (1802) als „für Cembalo oder Pianoforte“ bezeichnet werden konnten, spiegelt nur die letzten Atemzüge der antiken Hydra in der Öffentlichkeit wider. Eine Herrschaft ist vorbei, eine Herrschaft beginnt! Dieses brandneue Instrument, wird er mit Leidenschaft verfolgen und dabei jede neue Eroberung der Mechanik, jeden Zentimeter Bodengewinn im Bass oder Diskant der Tastatur – bis zu sechs Oktaven und einer Vierteloktave der Klavier-Sonate N° 29 in B-Dur, Op. 106 „Hammerklavier“ (1819) - auszunutzen. Die Geschichte dieser Musik ist die der Begegnung eines leidenschaftlichen Individualisten, eines großen Unabhängigen, eines Einzelgängers mit dem einzigen Instrument, das in der Lage war, diese für ihn ungewöhnliche „unendliche Oktave“ der Emotionen zu reproduzieren und zu übersetzen – eben jenes Instrument, das die Romantiker zu ihrem intimsten Vertrauten machten.

Man sollte nicht vergessen, dass Beethoven wie Mozart, ein herausragender Pianist war. Während des großen Konzerts im März 1795, das den Ruf von Joseph Haydns (1732-1809) jungem Schüler begründete, feierte Wien besonders den Virtuosen. Wie Mozart improvisierte er vor dem Publikum, dies bescherte uns zunächst eine Reihe von Variationen über Arien aus mondänen Opern. Doch dieses weltliche Leben währte nur kurz. Bald beschränkten ihn sein empfindlicher Charakter, sein Stolz, seine wachsende Menschenfeindlichkeit und die schreckliche Taubheit, die ihn sehr quälte, auf dieses Instrument, dem Mozart bereits – leider zu selten – einige Stimmungen oder Nervenkrisen anvertraut hatte: Die Fantasie N° 4 in c-Moll, K. 475 (1785) das Rondo in a-Moll, K. 511 (1787) das Adagio in h-Moll, K. 540 (1788). Beethoven übernimmt die Nachfolge! Er hatte sich, wie alle anderen, mit der Sonate beschäftigt, er erweckte diese Form als ein Abenteuer zum Leben. Er war wahrscheinlich der Erste, wenn wir Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) ausnehmen, der sich ihr und damit dem Instrument anpasste. Subjektives Klavier! Die meisten seiner Freunde hörten ihn seine Musik zu kommentieren. Er war ganz darin: Sein Geist, seine Kultur, sein Glaube an den Menschen und das Leben selbst. Ebenso die Alarme des Herzens und des Körpers. Er hätte die „Programme“, die seinen Werken seit jeher innewohnen auch nicht verleugnet.
Mozart – und Haydn auch nicht – schrieb nie etwas, das die vernünftigen Grenzen des Klaviers und der Pianisten überschritt. Aber auch Mozart hielt sich meist in Grenzen der Bescheidenheit. Aber Beethoven, zu Extremen getrieben, übertreibt es musikalisch und pianistisch. Zeitlebens wurde er für die Schwierigkeiten seiner Sonaten kritisiert, das liegt sicherlich an ihrem Inhalt – „unverständlich“, das Wort fällt oft in der Kritik der Zeit -, aber größtenteils an der instrumentalen Technik, die sie erfordern. Kurz gesagt, Mozarts Virtuosität basiert auf Tonleitern und Arpeggien. Das von Beethoven gehört sofort zu einer anderen Schule!
Bezeichnend ist, dass seine „erste“ offizielle Klavier-Sonate N° 2, N° 1 in c-Moll, Op. 111 (1821/22) mit einem Prestissimo endet, einer für Mozart fremden Vorstellung – was ihn jedoch nicht daran hindert, gleichzeitig die langsamsten Sätze, Largo oder Grave, vorzuschreiben, denen Mozart gegen über ebenfalls widerspenstig ist. Oktaven und Doppelnoten werden immer häufiger. Beethoven liebt es, schnell massive und kraftvolle Akkorde aneinanderzureihen. Er scheut keine Ausdehnung, keinen Sprung zurück! Er mag den Vorgang des abwechselnden Händewechsels, nah oder fern, beim trockenen Hämmern oder bei leichten Klängen. Die linke Hand gewinnt mit ihm diese Unabhängigkeit, diese Flexibilität zurück, die sie seit Johann Sebastian Bach (1685-1750) – seit den Klavierorgeln! – und er fügt noch einige Tollkühnheit hinzu. Die Triller werden länger und schwieriger, er betrachtet sie nicht nur als abschließenden Schmuck, sondern setzt sie dazu ein, das gesamte Instrument in Schwingung zu versetzten und betrachtet sie schließlich als Klangkörper für sich – den berühmten Triller des Rondo aus der Klavier-Sonate N° 21 in C-Dur, Op. 53 „Waldstein“ (1805) oder diejenigen, die die gesamte „Hammerklavier“-Sonate bewohnen. Oder auch die Arietta aus Op. 111. Lange vor Claude Debussy (1862-1918) kannte er „die tausend Möglichkeiten, Pianisten so zu behandeln, wie sie es verdienen“.

Wenn sie nur rein technisch eingesetzt werden, erzeugen diese Mittel nur ermüdende „Giganten“. Bei Beethoven wie auch bei seinen Vorgängern Muzio Clementi (1752-1832) und Jan Ladislav Dussek (1760-1812), denen er einen Großteil seiner Schriften verdankt, stehen sie im Dienst eines reichen und kraftvollen Denkens. Darüber hinaus sind seine Werke stets originell und von unbegrenzter Vielfalt. Mit dieser schon früh offenbarten Besonderheit, dass die Idee, das elementare thematische Material, der architektonische Stein, der dem gesamten Bau zugrunde liegt: Vorrang vor der Melodie selbst und sogar vor der Harmonie hat! Die unvergesslichen Phrasen, die verstörenden Sequenzen werden wir bei Mozart, bei Franz Schubert (1797-1828), - sogar bei Dussek und Clementi entdecken, ohne die Söhne von Bach zu vergessen und selbst Bach in seinen Tagen des „sensiblen Stils“. Neben der Logik – die auch die Kunst ist, überflüssiges zu vernichten – zeichnet Beethoven vor allem seine gewaltige Kraft aus, diese ihm fast unbekannte Macht, die Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) sagen ließ: „Es scheint, als würde das Haus einstürzen.“ Wenn wir ihr anderswo begegnen, verwenden wir spontan das Adjektiv „beethovenartig“, selbst in Verbindung mit Haydn oder Mozart. Diese Kraft drückt sich im Rhythmus aus! Schon das Lesen einer thematischen Tabelle seiner Klavier-Sonaten verdeutlicht diesen anfänglichen Sprung. Hier ist das Klavier unverzichtbar! Ohne unbedingt für das Instrument zu komponieren, ergründet Beethoven als Erster die volle Tragweite einer pianistischen Geste. Solch eine dramatische Woge, solch ein Fieberschauer scheint wahrhaftig den Fingern, der Hand, dem Arm, den Schultern zu entspringen: Und ebenso – da wir nur allzu sehr dazu neigen, Beethoven das romantische Bild eines ewig Depressiven aufzudrängen, verbergen wir schamlos seine robuste Fröhlichkeit – solch ein ausgelassenes Lachen, solch ein Stimmungs- und Humorsprung. Dies mag paradox erscheinen, da es aus diesem Gehirn kommt, aber es ist nur halb so, seine Gedanken verwandeln sich augenblicklich und wie unwiderstehlich in eine Materie. Selbst am Ende, wenn seine Ohren ihn endgültig von der Welt der Klänge isoliert haben, wird ihn seine Verachtung für das Sinnliche dieser Musik nicht darin hindern, das Klavier zu verherrlichen, wie es kein anderer je vermochte.
Lassen wir uns außerdem genauer auf die Beethoven-Technik eingehen. Sie ist nicht nur ein Feuerwerk der zehn Finger, bei dem Alessandro Scarlatti (1660-1725) auch Beethoven über mehrere Tastenlängen lang hart schlagen würde. Sie hängt auch von der Vielfalt des Anschlags, den Ausdrucksangaben und den Pedaleffekten ab. Der Gegensatz des „tenuto sempre“ der rechten Hand zum „staccato sempre“ der linken Hand in den langsamen Sätzen der „zweiten“ und „vierten“ Sonate ist ein Beispiel unter hundert und eines der am wenigsten ungeschickten für die Sorgfalt, mit der die Klangebenen gestaltet wurden. Die Fülle der Hinweise, die man im Rezitativ von Op. 110 liest, lässt darauf schließen, das Beethoven selbst wenn man Carl Czernys (1791-1857) Aussage, er habe das Largo des Klavier-Konzert N° 3 in c-Moll, Op. 37 (1803) durchgehend mit getretenem Pedal gespielt, nur halbwegs Glauben schenkt, die Wirkung des Nachhalls genossen hat, wenn man den an solchen Stellen des Sturmes – den Rezitativen der Reprisen – dem Thema Rondo – oder der Appassionata - dem ersten Satz – vorgeschriebenen „impressionistischen“ Nebel sieht, die Falten des Sourdine (ganz leise) „una corda“, unter anderem im Adagio von Op. 101: Oder der des „Hammerklavier“.

Der Klaviersatz bei Mozart wurde mit dem der menschlichen Stimme verglichen und der von Haydns Klavier mit dem Streichquartett. Es ist sicherlich das gewaltige Orchester, das Beethovens Klavier heraufbeschwört. Masseneffekte mit großen Akkordverschiebungen, Tremolos, Verdoppelungen in allen Registern. Heftige Dynamik, fortan untrennbar mit dem Namen Beethoven verbunden, mit ihren Nuancenkontrasten, von extremer Sanftheit bis Brutalität, ihren Sforzando, die zu einem unerwarteten Pianissimo führen. Imitation von Instrumentalklangfarben, die Franz Liszt (1811-1886) vorwegnehmen: Die Hörner des Motivs Lebewohl in der Abschieds-Sonate, das dumpfe Rollen der Pauken im Trauermarsch aus Op. 26, hier die Flöte oder die Oboe, dort die Bögen. Die Tastenmusik vor ihm scheint mit Bleistift gezeichnet zu sein, wobei jeder versucht, ihre Blässe zu mildern, indem er an Relief, Perspektive und Tiefe arbeitet: Seine Ausbrüche mit allen Farben einer großartigen Palette!
Die Klavier-Sonaten…
Man sagt, Das Wohltemperierte Clavier, BWV. 846/893 (1722/1743) sei das Alte Testament des Klaviers und Beethovens Sonaten das Neue. Zwischen der Fertigstellung der einen und dem Beginn der anderen liegt jedoch ein halbes Jahrhundert. In dieser Zeit wurde die Sonate Beethovens Zeitgenossen so vertraut, wie es die Fuge bei Bachs Zeitgenossen sein konnte. Als Beethoven begann, sie zu schreiben – ab 1782, aber beginnen wir nur mit Op. 2 – hatte er fertige Modelle vor Augen, die nur schwer weiter zu perfektionieren waren. „Empfange er aus den Händen von Haydn die Geschicklichkeit und den Geist von Mozart“, schrieb Ferdinand Ernst Graf von Waldstein (1762-1823) ihm am Vorabend der großen Abreise im Oktober des Jahres 1792. Aber Haydn scheint ein mittelmäßiger Lehrer gewesen zu sein und Beethoven versäumt es, angesichts des Mangels an Op. 2 ihn zu erwähnen, dass er sein Schüler ist. Aber durch seine eigenen Sonaten, von denen viele bewundernswert sind, konnte er den alten „Papa Haydn“ sowohl Mozart und Johann Christian Bach (1735-1782) als auch Carl Philipp Emanuel und Clementi überragen.
Auch nimmt Beethoven dieses Erbe bereitwillig an und wacht sogar sorgfältig darüber. Die Romantiker wollten in ihm nur Chaos und Aufruhr sehen! Das hieße aber, ihn falsch zu verstehen! Jeder seiner musikalischen Schritte ist von langer Hand geplant. Er beschränkt sich zunächst – bis Op. 22 – auf kleine Erneuerungen, die von einem tiefen Bedürfnis diktiert werden und die Festigkeit der Form nicht untergraben. Lassen wir uns der Reihe nach zitieren: Bearbeitung der Sonate in vier Sätzen nach dem Vorbild der Symphonie und des Quartetts – sechs von elf Mal, es gibt keine bei Mozart, zwei bei Haydn - , Ersatz des schweren Menuetts durch das agile Scherzo, einleitentendes Allegro mit einer langsamen Einleitung – der „Pathetik“ nach Dussek, er wird es noch viermal wiederholen, im „Sturm“, in den Abschieden, Op. 78 und 111. Aber das sind Details! Die Neuheit liegt woanders und hat eine bessere Konsequenz: Die Individualisierung von Themen, die wachsende Bedeutung der Coda. Die Dichte und Konzentration langsamer Bewegungen und vor allem aber die strenge thematische Arbeit mit dieser angeborenen Logik. Dieser klaren Sicht auf die Proportionen, die es ihm ermöglicht, das kleinste Motiv und sogar das Fragment eines Motivs auszunutzen? Dessen mühsame Ausarbeitung zwanzigmal auf den Wiederherstellungen in den Skizzenbüchern verfolgt werden kann. – Lassen wir uns nebenbei diese Realität betonen, die oft unbemerkt bleibt: Von allen Feldern, die der junge Beethoven bestellt hat, ist die Klavier-Sonate diejenige, die die reifsten Früchte hervorbringt. In dieser ersten Periode können weder Quartette noch Konzerte noch Symphonien mit ihr mithalten. In den vierzehn aufeinanderfolgenden Sonaten – Op. 49 aus den Jahren 1795/97 ist hier nicht mitgezählt – zeugen diverse Unfälle von einem überlegten Wunsch nach Veränderung. Beethoven ist sich bewusst, dass er sich in seiner Musik nun vollständig ausdrücken kann und strebt, während er seine eigene Sprache stärkt, nach einer tieferen Einheit in der Sonate. Er schüttelt den Rahmen, er experimentiert! Es beginnt um die Jahrhundertwende mit einem regelrechten Umbruch: Op. 26 und 27 kehren die Reihenfolge der Sätze um, verzweigen sich teilweise in mehrere Silben, beziehen Fremdkörper ein – der Trauermarsch aus Op. 26 -. Die Zwillinge von Op. 27 glauben, Kritik vorwegzunehmen, indem sie sich selbst als „quasi una fantasia“ bezeichnen. Die letzten Sonaten sind aber ohne solche Skrupel… Und wenn Beethoven, im Herzen als ein Klassiker zur Tradition zurückkehrt, dann mit seinen vier Stücken, Op. 54, 78 und 90 in zwei Sätzen, zeigen auch gleichzeitig eine Schwäche für die kleine Form. Was die „Abschieds“- Sonate betrifft, so scheut er sich nicht, wieder an die Programmemusik anzuknüpfen, die dem Johann Kuhnau (1660-1722) in den biblischen Sonaten – und in der Tat auch die Sonate in g- Moll, Op. 50, N° 3 „ Didone abbandonata“ (1821) von Clementi – am Herzen liegt.

Schließlich sind die letzten fünf Sonaten keine Selbstgespräche mehr: Früchte der Einsamkeit! Der Musiker erhebt sich zum Universellen, er wird in den Worten von Igor Strawinsky (1882-1971) : „Für immer unser Zeitgenosse sein“. Mit völliger Freiheit entziehen sich diese Stücke jeder Analyse! Beethoven schafft seine eigenen Formen, kombiniert die widersprüchlichsten Elemente und begrüßt die Fuge, das Rezitativ, die Variation, baut seine Musik nach dem Finale auf, das zum Höhepunkt des Werkes geworden ist und der immer schwieriger werdende Klaviersatz droht den Rahmen des Instruments zu sprengen.
Alles in allem wären diese Sonaten minimiert worden, wenn wir sie nur als einen Kampf gegen eine etablierte Form dargestellt hätten. Sie sind vor allem wegen ihrer Vielfalt wertvoll, wegen der überraschenden Individualität der Geringsten unter ihnen: Sie sind nicht austauschbar! Es ist kein Park mit geradlinigen Wegen, gepflegten Blumenbeeten, gestutzten Büschen und klugen Rasenschalen, sondern ein natürlicher und wilder Garten, in dem wir je nach Wunsch diesen Baum betrachten, diesen anderen vernachlässigen und oft zu diesem dritten zurückkehren, dessen Geruch uns nie verlässt. Auch dies ist es, was man von seinen Vorgängern oder Zeitgenossen komponierten „Reihen“ nicht sagen kann: Ein Zeichen von Beethovens gewaltiger Genialität.
Zum Klavier-Abend im KKL Luzern / Konzertsaal am 7. September 2025 im Rahmen des Festival Luzern 2025:
Mitsuko Uchida interpretiert Beethovens letzte Sonaten noch einmal…
Eine unserer weisesten Pianistinnen trat in den Konzertsaal des KKL Luzern mit einigen der weisesten Stücke auf, die für ihr Instrument geschrieben wurden.
Eine Sache, die eingefleischte Klassikfans in der Konzertpause gerne tun, ist sich auszutauschen - über die laufende Aufführung, darüber was sonst noch in der Stadt los war und was noch als Nächstes kommt.
Während eines dieser Gespräche fragten wir kürzlich einen Freund, ob er vorhabe, sich das Konzert der Pianistin Uchida mit den späten Beethoven-Sonaten im KKL Luzern anzusehen. Er sagte nein, er müsse sie nicht wieder mit diesem Repertoire auseinander setzten.
Bis zu einem gewissen Punkt verständlich! Sie ist mit dieser Musik schon früher auf Tournee gegangen und hat sie 2006 auf wunderbare Weise aufgenommen. Doch die 74-jährige Uchida ist eine Künstlerin, die immer wieder auf Vertrautes zurückgreift, insbesondere auf die Werke von Mozart, Schubert und Beethoven und dies im Rahmen eines lebenslangen Plädoyers für die Vorteile wiederholter Auseinandersetzungen. „Die großen Komponisten verändern sich ständig“, sagte sie einmal in einem Interview. „Und wenn man sich verändert, verändern sie sich auch“.
Bei ihrem Konzert von Beethovens letzten drei Klaviersonaten am 7. September im KKL Luzern wirkte Uchida tatsächlich wie eine andere Künstlerin als die, die diese Werke vor fast zwei Jahrzehnten aufgenommen hat. Wir glauben nicht, dass Alter in der Musik grundsätzlich notwendig oder hilfreich ist – Igor Levit hatte Beethovens späten Stil schon in den Zwanzigern im Griff -, aber was auf der Bühne widergespiegelt wurde, war die ungekünstelte Weisheit und Klarheit, die sich aus jahrzehntelanger interpretatorischer Strange und Hingabe ergibt.
Uchidas Aufnahme dieser Stücke ist beharrlich lyrisch schon fast Schubert-Haft. Die Sonaten waren in ihrer damaligen Interpretation intime, private Betrachtungen, die zwar öffentlich gemacht wurden, aber nicht notwendig erschienen. Hier im KKL Luzern war ihr Klang oft vergleichsweise hell und extrem – die Sforzando wahre Explosionen, die Pianissimo herrlich leise. Jede Sonate entfaltete sich mit improvisatorischer Freiheit, absolut lebendig, ihr Herz strahlte mehr als ihr Verstand. Doch dank Uchidas Technik, ihrer Pedalarbeit und Präzision wirkten die Partituren auch transparent und vielschichtig. Man konnte mit beeindruckender Leichtigkeit jede einzelne Linie hören, die sich durch die Fuge des Finals von Op. 110 zog. Damals wie heute war ihr Spiel überzeugend: Beethovens Musik kann beiden Ansätzen standhalten, ja sie sogar fordern!
In ihrem Op. 109, der Sonate N° 30 in E-Dur, erreichte und senkte sich der beschwingte Vivace-Auftakt mit Wucht – eher eine Welle als ein Kräuseln, aber in seiner verführerisch langen Linie immer noch aus derselben Quelle schlagend. Dieses Werk und die beiden anderen auf dem Programm können schwierig zu singen sein, eine Melodie aus verworrenen Rhythmen und kniffligen Fingersätzen herauszukitzeln, hier im KKL-Luzern verlieh Uchida jedem Finger genau das richtige Gewicht, um den Kontrapunkt zu betonen und die Architektur der Partitur freizulegen, ohne von den singenden Melodien abzulenken, die sie unterstützt.
Stellenweise, insbesondere in der Sonate in As-Dur Op. 110, näherte sich ihr Klang dem von Liedern Schuberts, der mit Bach die Plätze zu tauschen schien, als das Arioso mit einer komplizierten dreistimmigen Fuge abwechselte. In Uchidas Händen erreichte dieses Finale – in Beethoven‘ scher Manier eine Reise von tiefer Verzweiflung zu euphorischen Höhen – eine Art heilige Erhabenheit.
In ihrer Interpretation des Op. 111 in c-Moll erreichte sie sogar noch höhere Ziele. In der abschließenden Arietta – nach dem geradlinigen Thema und den ersten Variationen darüber, darunter eine, die bekanntermaßen wie ein Blick in die jazzigere Zukunft der Musik swingt -, schien sie, als noch viel Partitur vorlag, alles Vorherige hinter sich zu lassen. Mit funkelnden Trillern und einem eher persönlichen als performativen Spiel folgte sie Beethovens Sprung in den Kosmos und blieb bei ihm bis zum geflüsterten Schlusstakt.
Danach kehrte Uchida mehrmals auf die Bühne zurück, um sich zu verbeugen, aber nie, um eine Zugabe zu geben: Wie hätte sie auch können? In ihrer typischen Art wirkte sie jedes Mal -, wenn sie sich dem Publikum zuwandte, erst überrascht, dann dankbar – als ob sie, nachdem sie alles mit uns geteilt hatte, diejenige wäre, die uns danken sollte. Ein gewaltiger und verdienter Applaus für diese kleine zierliche und doch so große Künstlerin: Dame Mitsuko Uchida!