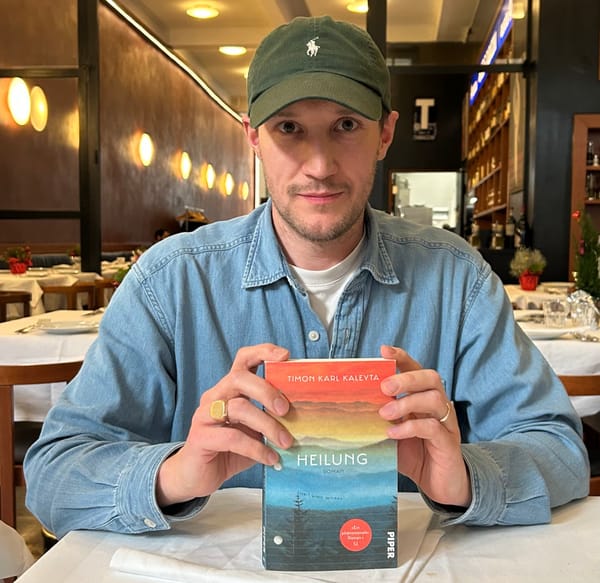COLMAR, Église Saint-Matthieu, Yuja Wang - FESTIVAL INTERNATIONAL DE COLMAR 2025
Kritik zum Konzert von Yuja Wang & Mahler Chamber Orchestra am 9.7.2025 in Colmar – Beethoven, Kapustin, Stravinsky, Tschaikowsky.

09.07.2025
YUJA, DOMPTEUSE DES FEUERS…
Die leidenschaftliche chinesische Virtuosin Yuja Wang präsentierte uns heute Abend nicht nur ein, sondern gleich zwei Klavierkonzerte! Neben dem berühmten Klavierkonzert N° 1 in b-Moll, Op. 23 von Tschaikowsky, einem Denkmal der russischen Romantik auf ihrem Höhepunkt, präsentiert sie uns auch noch ein zweites Klavierkonzert N° 2 in f-Moll, Op. 11 von Chopin, ein zweiter absoluter Höhepunkt der Romantik. Zu diesem Anlass dirigierte Wang selbst am Klavier das renommierte Mahler Chamber Orchestra.
Poesie in Bewegung…
Ludwig van Beethoven (1770-1827): CORIOLAN, Op. 62 (1807)
Die Ouvertüre Coriolan von Beethoven ist ein kurzes, aber auffallend dramatisches Werk. Sie wurde als Begleitung zur gleichnamigen Tragödie (1804) des österreichischen Dramatikers Heinrich Joseph von Collin (1771-1811) geschrieben und nicht, wie oft angenommen, für ein Stück von William Shakespeare (1564-1616). Getreu seinem Ideal des Helden, der gegen das Schicksal kämpft, hat Beethoven ein kurzes, aber strahlendes Meisterwerk geschaffen. Eine wahre musikalische Tragödie im Kleinen, deren dramatische Wirkung bis heute packend ist.
In dieser Ouvertüre illustriert Beethoven mit seltener Ausdruckskraft den tragischen Konflikt des Helden, eines römischen Generals, der aus seiner Heimat verbannt wurde und bereit ist, sie zu zerstören, um seine beschädigte Ehre zu rächen, bevor er von Zweifeln zerfressen, den Bitten seiner Mutter nachgibt. Anders als die traditionelle Ouvertüre einer Oper oder Komödie wird die Konzert-Ouvertüre nach Beethoven zu einem eigenständigen und dramatischen Werk. Von den ersten Takten an wird der Hörer in eine Welt voller Spannungen und Kontraste entführt. Die beiden Eröffnungsakkorde, abrupt und düster, erzeugen ein Klima der Gewalt und Dringlichkeit. Das Hauptthema, heroisch und kantig, repräsentiert die Starrheit und Entschlossenheit von Coriolan. Dieses Motiv zeichnet sich durch seine energischen Intervalle, seine hämmernden Rhythmen und seinen eigensinnigen Ton aus. Im Gegensatz dazu verkörpert ein zweites, lyrisches Thema in Streichern die Stimme der Mutter des Helden, flehend, süß und menschlich. Darin liegt die Originalität von Beethoven: Es beschreibt einen narrativen Konflikt in eine musikalische Form.

Mit Coriolan eröffnet Beethoven eine neue Sichtweise auf die Ouvertüre: Sie ist nicht mehr bloßes Vorspiel, sondern eine dramatische Zusammenfassung der kommenden Handlung. Das Werk nimmt die großen symphonischen Dichtungen von Franz Liszt (1811-1886) vorweg und wird Hector Berlioz (1803-1869) maßgeblich beeinflussen. Die Uraufführung fand am 5. März 1807 im Palais von Fürst Joseph Franz von Lobkowitz (1772-1816) in Wien im Rahmen eines Privatkonzerts statt, das mehreren neuen Kompositionen von Beethoven gewidmet war, darunter auch die Symphonie N° 4 in B-Dur, Op. 60 (1807) und seinem Klavierkonzert N° 4 in G-Dur, Op. 58 (1808).
Frédéric Chopin (1810-1849): KLAVIER-KONZERT N° 2 in f-Moll, Op. 21 (1830)
Obwohl Chopins: Klavierkonzert N° 2 erst als zweites veröffentlicht wurde, war es tatsächlich sein erstes Konzert. Nach einem überraschend erfolgreichen improvisierten Solodebüt in Wien kehrte der neunzehnjährige Komponist nach Warschau zurück, um ein Konzert zu komponieren, das er später auf Tourneen spielen konnte. Chopin vollendete es im Herbst 1829 und gab im darauffolgenden März die Uraufführung in Warschau, wo es begeistert aufgenommen wurde.
Der erste Satz beginnt mit einer umfangreichen Orchesterpassage, die seine Hauptthemen einführt: Das erste ist eine romantische Melodie mit starken dynamischen Kontrasten in f-Moll; das zweite ist eine lyrischere Melodie, die von den Holzbläsern in As-Dur eingeleitet wird. Wenn das Klavier einsetzt, interpretiert es das erste und zweite Thema neu, mit Ornamenten, die von den ausdrucksstarken Verzierungen der Belcanto-Opernsänger inspiriert sind. Obwohl das Klavier technisch gesehen ein Schlaginstrument ist, war Chopin ein Meister darin, sanfte singende Legato-Melodien dafür zu schaffen. Diese lyrischen Themen werden durch exquisit ausgearbeitete virtuose Passagen überbrückt, die Chopins Gespür für die Klangfülle des Klaviers zeigen. Nach einer kurzen, aber intensiven Passage für Orchester kehrt der Pianist zurück, um die zuvor eingeführten Ideen weiterzuentwickeln. Die Musik beginnt ruhig, wird dann unaufhaltsam stürmischer und steigert sich zu einer feurigen Passage für Orchester. Der Solist kehrt dann mit dem ersten Thema zurück, das schnell in das zweite übergeht. Der Satz endet mit virtuosen Passagen und einer entscheidenden Orchester-Coda in f-Moll.
In einem Brief an einen Freund gestand Chopin, dass der langsame zweite Satz des Konzerts von Konstancja Golodkowski (1810-1889) inspiriert wurde, einer jungen Sängerin, die mit ihm am Konservatorium in Warschau studierte: „Vielleicht zu meinem Unglück habe ich mein Ideal gefunden und ihm sechs Monate treu gedient, ohne mit ihr über meine Gefühle zu sprechen. Ich träume davon: Unter ihrer Inspiration sind das Adagio meines Konzerts in f-Moll und heute Morgen der kleine Walzer entstanden, den ich Ihnen schicke [den Walzer in h-Moll, Op. 69, N° 2 (1829)] … Ich erzähle dem Klavier, was ich Ihnen anvertraute“.

Unglücklicherweise für den schüchternen Komponisten ist diese Musik alles, was aus seiner unausgesprochenen Verliebtheit hervorging. Viele Kritiker betrachten diesen Satz noch immer als eine seiner schönsten Schöpfungen und vergleichen ihn mit den Nocturnes, die er später komponieren sollte. Nach einer kurzen Orchestereinleitung spielt das Klavier eine lange singende und poetische Melodie. Dies führt zu einem kontrastierenden Mittelteil, der dramatisch mit Tremolo-Streichern beginnt. Darüber imitiert der Pianist ein Opernrezitativ, als würde er sprechen, anstatt Musik zu spielen! Dann erscheint die lyrische Melodie erneut und der Satz endet, wie er mit der Orchestereinleitung begonnen hat.
Das Finale beginnt mit einer Melodie im Stil einer Mazurka, einer Art polnischem Tanz. Virtuose Passagen führen dann zu einem Kontrastierenden, rustikalen Thema in As-Dur, begleitet von Streichern, die col legno mit dem Holz des Bogens spielen. Nach der Wiederkehr des Mazurka- Eröffnungsthemas leitet ein Horn-Solo eine brillante Coda in F-Dur ein.

Igor Strawinsky (1882-1971): OKTETT FÜR BLASINSTRUMENTE, W. 51 (1923)
Das zwischen 1922 und 1923 größtenteils in Biarritz und Paris komponierte Oktett für Blasinstrumente markiert einen entscheidenden Wendepunkt in Strawinskys Karriere. Er lässt die expressiven Exzesse seiner russischen Periode und seine extravaganten Ballette: L’Oiseau de feu (1910) oder Le Sacre du Printemps (1913) hinter sich und wendet sich einer verfeinerten, referenziellen Ästhetik zu, die durch eine Rückkehr zu formaler Klarheit und dem Kontrapunkt gekennzeichnet ist: Dies ist der Beginn seiner neoklassischen Periode! Dieses am 18. Oktober 1923 an der Opéra National de Paris unter der Leitung des Komponisten selbst ist für eine seltene Besetzung geschrieben: Flöte, Klarinette, zwei Fagotte, Trompete in C, Trompete A, Tenorposaune und Bassposaune. Dieses einzigartige Ensemble ermöglicht es Strawinsky, neue Farben und eine musikalische Architektur von höchster Präzision zu entdecken.
Fernab von symphonischem Pomp schlägt das Oktett den Ton einer sehr raffinierten, aber stets ironischen Kammermusik an. Strawinsky lässt sich von klassischen Formen inspirieren, ohne sich ihnen je zu unterwerfen: Er persifliert, verzerrt und spielt mit den Erwartungen des Zuhörers. Er selbst beschreibt sein Oktett als ein „reines Instrumentalstück“, ohne Programm, aber reich an formalen und stilistischen Spielereien.

Der erste Satz, Sinfonia, präsentiert eine Sonatenform. Der Kontrapunkt ist von großer Finesse und die Dialoge zwischen den Abschnitten erzeugen eine klare Polyphonie. Die Dissonanzen sind kunstvoll dosiert und die rhythmischen Überraschungen erinnern daran, dass sich bei Strawinsky hinter scheinbarer Ordnung oft ein subversiver Geist verbirgt. Der zweite Satz, Thema und Variationen, bietet ein erstaunliches Spiel aus Klang und rhythmischen Metamorphosen. Das sehr schlichte Anfangsthema dient als Vorwand für eine Reihe von Metamorphosen, in denen sich Pastiche, rhythmische Wechsel und humorvolle Miniaturen abwechseln. Jede Variation ist eine Welt für sich, die zwischen klassischer Strenge und skurriler Freiheit oszilliert. Das Finale beginnt mit einer kurzen langsamen Einleitung und führt dann in einen lebhafteren fugato-artigen Abschnitt. Der Satz endet in einer eleganten und brillanten Atmosphäre und beschließt das Werk mit einer Note, die zugleich leicht und meisterhaft ist.
Dieses Oktett gilt oft als Manifest von Strawinskys neoklassischer Periode und veranschaulicht seine Ablehnung von Expressionismus und romantischer Introspektion zugunsten einer formaleren, aber nicht geistlosen Musik. Dieses brillante und verspielte Werk lässt die Meisterwerke dieser Ästhetik erahnen: Pulcinella (1920), Apollon musagète (1928) oder noch die Symphonie in C (1940).
Piotr Ilitsch Tschaikowsky (1840-1893): KLAVIER-KONZERT N° 1 in b-Moll, Op. 23 (1875)
Das zwischen November 1874 und Februar 1875 komponierte Klavierkonzert N° 1 ist zweifellos Tschaikowskys beliebtesten Konzertwerk, 1875 in Boston vom Pianisten Hans von Bülow (1830-1894) interpretiert – obwohl das Werk Nikolai Rubinstein (1835-1881) gewidmet war, der die erste Fassung heftig kritisiert hatte – etablierte sich dieses Konzert schnell als eine Säule des romantischen Repertoires. Sein Erfolg beruht sowohl auf seinem lyrischen Atem, seinem thematischen Reichtum und seiner spektakulären Virtuosität als auch auf der ständigen dramatischen Spannung zwischen Solist und Orchester. Beachten wir, dass das Werk, dass wir gewohnt sind zu hören, nicht genau dem entspricht, was das Publikum bei der Premiere hörte: Tatsächlich überarbeitete Tschaikowsky seine Partitur zweimal und legte ihr eine zweite Version für die russische Premiere in Sankt Petersburg im Jahr 1884 vor, bevor er 1888 eine endgültige Version für Hamburg vorlegte.
Von den ersten Takten des Allegro an wird der Ton vorgegeben: Gewaltige Orchesterakkorde, eine majestätische Klavierantwort in Arpeggien und Oktaven, ein breites und edles Thema, das den Hörnern und Streichern anvertraut wird. Ironischer Weise kehrt dieses einleitende Thema – eines der berühmtesten des Repertoires – im Rest des Satzes nicht wieder. Das eigentliche erste Thema, viel kantiger gibt den Ton für die Durchführung an. Das Klavier ist sowohl perkussiv als auch lyrisch und verbindet schwindelerregende Passagen voller Bravour mit Melodien von slawischen Akzenten. Die sonatenartige Struktur ist mit lyrischen und dramatischen Episoden angereichert und unterstreicht Tschaikowskys Fähigkeit, formale Strenge und expressive Intensität zu verbinden. Nach der feierlichen Eleganz des ersten Satzes bietet das Andantino einen Moment der Anmut und Intimität. Ein volkstümliches Thema wird von der Flöte präsentiert und vom Klavier in zarter Melancholie aufgegriffen. Ein mit Prestissimo bezeichneter Mittelteil erzeugt einen lebhaften, fast tänzerischen Kontrast, bevor das Hauptthema wiederkehrt. Dieser Satz erinnert an Tschaikowskys Folklore-Wurzeln und seine Kunst des Helldunkels: Die scheinbare Leichtigkeit verbirgt oft eine ergreifende Tiefe. Das Finale beginnt mit einem perkussiven, synkopierten rhythmischen Motiv, das das Klavier energisch entwickelt. Auch dieser Satz bedient sich der slawischen Tradition: Volkstänze, Leidenschafts-Ausbrüche, abrupte Kontraste. Die pianistische Virtuosität erreicht ihren Höhepunkt, löst sich aber nie vom symphonischen Atem. Ein lyrisches Thema, das in der Mitte eingeführt wird, sorgt für frischen Wind vor einer brillanten und unwiderstehlichen Coda, die das Konzert in einer Explosion von Kraft und Begeisterung abschließt.

Das Klavierkonzert N° 1 von Tschaikowsky ist ein Werk von Eroberung und Bestätigung, ein wahres romantisches Manifest, in dem das Klavier zum tragischen Helden, Liebhaber, Virtuosen und Dichter wird. Sein weltweiter Erfolg nach der Uraufführung in Boston sicherte dem Komponisten seinen Ruf über Russland hinaus. Dieses Konzert verkörpert Tschaikowskys Kunst perfekt: Intensiv lyrisch, brillant orchestriert, durchdrungen von Leidenschaft, Schmerz und Hoffnung.
Zum Konzert in l’Église Saint-Matthieu im Rahmen des Festival international de Colmar am 9. Juli 2025:
Geschwindigkeit, Flexibilität, pianistischen Ton und interpretatorische Nuancen...
Wie schon seit Beginn der Ausgabe 2025 des Festival International de Colmar strömt das Publikum am 9. Juli in Scharen in die Église Saint-Matthieu, dem Mittelpunkt der Veranstaltung. „Suche einen Platz!“. Wer keine der begehrten Karten ergattern konnte, versucht sein Glück vor der Veranda in der Hoffnung, Yuja Wang zu hören, die das erste Mal mit dem Mahler Chamber Orchestra in der elsässischen Stadt Halt macht.
Lieber Chopin als Kapustin…
Die Pianistin sollte Nikolai Kapustins (1937-2020) Klavierkonzert N° 4, Op. 56 (1989) spielen, der Veranstaltungsort jedoch eignete sich nicht unbedingt auf dieses jazzig-überschwängliche Werk – das ist noch untertrieben – und somit musste es zugunsten von Chopins: Klavierkonzert N° 2 verzichten, während Tschaikowskys: Klavierkonzert N° 1 für die zweite Hälfte vorgesehen war. So bleibt der Abend ein wahres Konzert-Fest! Zwar ist es von Anfang bis zum Ende bekannt, aber darüber kann sich niemand beschweren, wenn man es mit einer Solistin und einem Orchester dieses Kalibers zu tun hat. Phänomenale Beherrschung des Klavierspiels, Beethoven und seine Coriolan-Ouvertüre, mit Feuer und Fülle von José Maria Blumenschein, dem bemerkenswerten Konzertmeister des Mahler Chamber Orchester, angeleitet, gaben den Ton für einen Abend an, an dem nicht der Hauch einer beginnenden Pause zu spüren war. Überspringen wir Wangs eher symbolische Gesten, die sich im Dirigat und am Klavier ankündigen, um das Ergebnis, das sie am Klavier erzielt, besser zu würdigen. Wir haben Chopins f-Moll tausendmal gehört… und doch wirkt hier alles neu, unglaublich sprudelnd. Keine Freiheiten, keine „Tricks“ unter den Fingern der Solistin. Nur, wenn man so sagen kann, eine Beherrschung des Klangmaterials, eine Beherrschung von Dynamik und Farben, die wahrhaft phänomenal sind. Sie machen sprachlos, wie das Pedalspiel, mit einer Subtilität, die umso mehr Bewunderung gebietet, weil die Absätze hoch (!) sind. Wir messen auch die Professionalität einer Künstlerin, die sich an eine Akustik anzupassen vermag, die sie zum ersten Mal in ihrer Karriere erlebt.
Konzert N° 2 ? Tatsächlich das erste in der Reihenfolge der Kompositionen: Die Musik eines Teenagers, dessen Begeisterung Wang wiederentdeckt! Jede Note, jede Zeile mit einer Legato-Qualität poetisiert, die die Belcanto-Essenz der Partitur verstärkt. Üppig und unwiderstehlich!

Glühende Klasse…
Machen wir in der zweiten Hälfte Platz für russische Musik, beginnend mit Strawinskys viel zu selten gehörtem Oktett für Blasinstrumente, gespielt von einigen der hervorragenden Bläser des Mahler Chamber Orchestra. Eine lebendige Vision, voller Frucht und Tiefe – und nebenbei eine Gelegenheit für die Teilnehmer, sich aufzuwärmen, bevor sie sich an Tschaikowskys berühmtes Opus 23 wagen. Wie das vorangegangene Chopin-Konzert ist dies eines der beliebtesten Klavierkonzerte des romantischen Repertoire und wie in Opus 21 des polnischen Komponisten besticht Wang durch ihre Fähigkeit, in den Text einzudringen und all seine Kontraste und Nuancen auszunutzen. Die Mitglieder des Mahler Chamber Orchestra folgen ihrer Solistin wie aus einem Guss, extravagant, völlig engagiert, aber nie verworren oder emphatisch. Mit welcher Geschicklichkeit gelingt es ihr, die poetischen Momente des ersten Satzes auszuloten, ohne dessen Fluss in irgendeiner Weise zu verlangsamen. Welch unfassbare Virtuosität erreicht sie im prestissimo des Andante semplice: Sicherlich nicht gerade der spektakulärste Moment des Werks, aber zweifellos der aufschlussreichste über das Klavierniveau, auf dem wir uns befinden! Zu welchem gemeinsamen musikalischen Rausch – die wissenden Blicke der Instrumentalisten sprechen Bände – lädt sie uns zum Finale ein. Ein Fest, ja man kann sagen, das mit mehr als einem Fest mit unendlichen glühenden Klängen endet. Ein mehr als herzlich willkommener Abend, der sich wohl sofort in die Annalen des Festival International de Colmar einträgt und mit zwei Zugaben endet: Die Etüde Op. 76, N° 2 (1914) von Jean Sibelius (1865-1957) mit einem zart funkelnden staccato und eine Transkription für Klavier (1975) des Pianisten Wilhelm Kempff (1895-1991 der Ballet-Pantomime Balletto delle ombre allegre aus der Oper Orfeo ed Euridice, Wq. 30 (1774) von Christoph Willibald von Gluck (1714-1787) – ein Stück, das, wie man sich erinnert, dem verstorbenen Nelson Freire (1944-2021) am Herzen lag – serviert mit einer verblüffenden Kunst des sfumato. Was für ein Musiker! Was für eine Interpretin! Was für ein Abend!
Auskünfte und Karten: www.festival-colmar.com