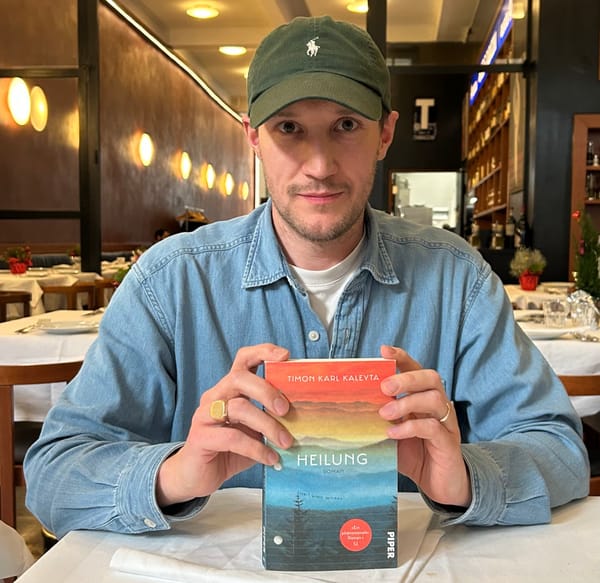Ulrichshusen, Konzertscheune, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Royal Philharmonic Orchestra, IOCO

Weltstars in Ulrichshusen
Daniel Müller-Schott und das Royal Philharmonic Orchestra London
Die Hütte voll, die Erwartungen groß! Wollte heißen: Kein Stuhl mehr frei in Ulrichshusens wahrlich großer Konzertscheune bei einem Abend, der jeder Wunschvorstellung entsprochen haben dürfte! Wie auch nicht, wenn sich mit dem Royal Philharmonic Orchestra London das weltweit wohl bekannteste und repräsentativste Orchester Großbritanniens vorstellt und Meistercellist Daniel Müller-Schott mit seinem Auftritt gleichzeitig seine nunmehr dreißigjährige Verbundenheit mit den Festspielen MV f eiert.
Nicht zu vergessen: mit Vasily Petrenko agierte ein musikalischer „Chef“, der dem Klangkörper seit 2021 vorsteht und dessen internationale künstlerische Biographie wahrlich beeindruckend ist. Unter solchen Aspekten durfte man einem Programm mit Neugier begegnen, das sich einerseits relativ traditionell gab, aber gerade damit erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich zu erwartender eigener gestalterischer Angebote in Aussicht stellte. Nehmen wir das Ergebnis vorweg: Hier blieben keine Wünsche offen!
Ein Ensemble mit traumhaftem Sound, „griffig“ im besten Wortsinne, (be)zwingend und also nicht loslassend, in hohem Maße klanglich verführerisch und dabei von fast therapeutischer Wirkung. Ein piano, das man kaum noch hört und das dennoch ob seiner Intensität besticht, ein fortissimo, das nicht überrumpelt, sondern überzeugt und mitnimmt.
Und eine Art zu musizieren, die in stetigem, mal mehr, mal weniger drangvollem Pulsieren alle denkbaren dynamischen Schattierungen anbietet und damit größte Lebendigkeit sichert. Ein Orchester, das „redet“ und mit stärkster „Mitteilungsdichte“ überzeugt. Von unaufdringlicher, aber fesselnder Ausdrucksintensität ganz zu schweigen.
Mit solcherlei künstlerischen, vor allem aber gestalterischen Qualitäten ist gut wuchern! Vasily Petrenko hatte also keine Mühe, „sein“ Orchester souverän zu beeindruckenden Höchstleistungen zu animieren. Dies zunächst äußerlich unaufwendig und nur scheinbar problemlos mit bestens Bekanntem: Edvard Griegs viersätziger Peer-Gynt-Suite Nr. 1 op, 46. Und die geriet gleich zur musikalisch ausgereiften, ungemein fein differenzierten Visitenkarte des Ensembles. Eine klanglich hochsensible, jeweils sehr athmosphärisch geprägte Aufführung.
Deren Qualität bestand schon mal darin, dass man keine Veranlassung sah, sich wohlig bloßem akustischen Hörgenuss hinzugeben. Eher schon folgte man einem unwiderstehlichen Zwang, besonders aufmerksam hinzuhören, um im Bekannten auch Unbekanntes zu entdecken.
Solch ein faszinierender Musizierstil war denn auch für das zentrale Solowerk von Bedeutung: Antonín Dvořaks Konzert für Violoncello und Orchester h-Moll op. 104. Dies umso mehr, als Solist Daniel Müller-Schott das gleiche Empfinden für eine hochsensible Musiksprache an den Tag legte. Gerade dieses noch in den USA innerhalb dreier Monate geschriebene Werk strotzt geradezu vor hinreißenden melodischen Einfällen sowie einer innigen, lyrischen Gefühlshaftigkeit und Intensität, die das Werk schon fast zu einer Ausnahmeerscheinung machen. Brahms war begeistert und meinte, hätte er gewusst, „dass man ein Cellokonzert wie dieses schreiben kann“, dann hätte er längst eines geschrieben.
Dieses Begeisterungspotenzial des Stückes hat sich unverschlissen bis heute erhalten. Und wenn Meister wie Daniel Müller-Schott und besagtes Londoner Orchester danach greifen, dann gibt es der ungetrübten Genussfaktoren viele, sehr viele! Zumal Solist wie Orchester in schönster Gemeinsamkeit agierten. Nicht selten ließen sie mit rhapsodisch anmutenden, bestimmte Abläufe agogisch rhetorisch prägnant profilierten Passagen aufhorchen, verwöhnten mit betörender Klangschönheit und dem genüsslichen Auskosten schier überquellendem Dvořakschen Einfallsreichtums; von der inspirierten, mitreißenden Verve der Allegroteile ganz zu schweigen. So erstand die ganze überaus vielfältige und dabei Virtuoses wie selbstverständlich als höchst attraktive Ausdrucksqualität nutzende Pracht eines Glücksfalls der Cello-Literatur, für deren authentische, bis zum letzten Ton ungemein faszinierende Präsentation keine Beifallsäußerung des enthusiasmierten Publikums heftig genug schien.
Und die steigerte sich noch nach dem letzten Werk des Konzertes. Kein schlechter Einfall, mit Nikolai Rimski-Korsakows Scheherazade op. 35 zu enden und den Hörer mit den wahrlich nicht alltäglichen Eindrücken einer sich exotisch gebenden, blendend instrumentierten und spieltechnisch brillanten Orchesterfantasie zu entlassen; mit der Gewissheit langanhaltender Nachwirkung.
Tatsächlich gehen einem diverse prägnante melodische „Ohrwürmer“ - aus dramaturgischen Gründen des öfteren wiederholt - nicht aus dem Kopf, und schon gar nicht die vielen raffiniert „farbigen“, im Wortsinne „märchenhaften“ (arabischen) Klangbilder. Nicht nur sie, aber auch sie veranlassten schon den Zeitgenossen Mitrofan P. Beljajew, millionenschwerer leidenschaftlicher Förderer nationaler russischer Musik, den Komponisten einen „Zauberer des Orchesters“ zu nennen. Es schadet nicht, das wörtlich zu nehmen und sich von der (um ihr Leben erzählenden) Prinzessin Scheherazade in die faszinierende Welt von Märchen aus Tausend und einer Nacht entführen zu lassen. Rimski-Korsakow tut das durchaus anschaulich, wollte aber – so in seiner Autobiographie nachzulesen – nicht zu konkret werden und lediglich mit „programmatischen Andeutungen...die Phantasie des Hörers behutsam in eine bestimmte Richtung lenken, während die Ausmalung der Details dem Vorstellungsvermögen und der Stimmung jedes einzelnen Hörers überlassen bleiben sollte.“ Nicht uninteressant: Der Komponist wollte deshalb sogar die „verführerisch programmatischen Satzbezeichnungen“ tilgen und lediglich neutrale Hinweise verwenden.
Unabhängig davon, wer schon will sich der Bild- und Wirkmächtigkeit einer Musik entziehen, die doch eben darauf angelegt scheint. Auch in Ulrichshusen dürfte das kaum geklappt haben. Sanfte programmatische Hinweise? Von wegen! Handfester Erzählgestus von einem Orchester, das sich in dieser Welt des durchaus höchst lebendiges Profil besitzenden Märchenhaften sichtlich wohl fühlte und Naturkräften (Meer, Wind, Schiffbruch) wie Personen und ihren Charakteren unvergesslich eindrucksvolle musikalische Gestalt verlieh. Und das ohne in bloße Illustration zu verfallen. Vier Sätze, vier Märchen, vier „Bilder“ - keine Sinfonie mit entsprechender formaler und dynamischer Strategie, „nur“ eine „Suite“; allerdings dennoch als „sinfonische Musik“ gedacht und eben nicht als eine nur lose Folge von einander unabhängigen Sätzen...
Darauf wäre man in Ulrichshusen ohnehin nicht gekommen. Dafür sorgten Petrenko und ein Orchester, das einen vom ersten Ton an packte und auch noch lange nach dem letzten nicht losließ.