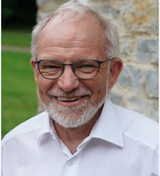Stuttgart, Staatsoper, DIE SCHLAUE FÜCHSIN - Leoš Janáček, IOCO
In Stuttgart wird Janáčeks „Die schlaue Füchsin“ zu einem poetischen Fest des Lebens: Stephan Kimmig und Ariane Matiakh entfalten eine sinnliche, berührende Natur- und Traumwelt, getragen von einem herausragenden Ensemble und einer packenden, farbenreichen Orchesterleistung.

von Peter Schlang
Ein Lob des Lebens, der Liebe und der Naturverbundenheit: An der Staatsoper Stuttgart machen Stephan Kimmig und Ariane Matiakh Leoš Janáčeks Oper „Die schlaue Füchsin“ zu einem sinnlichen Fest
Im Frühjahr 1920 veröffentlichte die Brünner Tageszeitung LIdové noviny unter dem Titel „Liška Bystrouška“ („Füchslein Schlaukopf“) eine Fortsetzungsgeschichte, die ihr Redakteur und Feuilletonist Rudolf Těsnohlídek nach den Zeichnungen des tschechischen Landschaftsmalers Stanislav Lolek verfasst hatte. Leoš Janáček bekam diese äußerst populäre Geschichte über das Verhältnis von Menschen und Tieren einige Zeit später über Umwege zu Gesicht und war von ihr so begeistert, dass er sie zur Vorlage für ein Opern-Libretto nahm. Seine darauf komponierte Oper „Das schlaue Füchslein“ wurde am 6. November 1924 am Opernhaus in Brünn uraufgeführt.
Gut 100 Jahre später, am 9. November 2025, erlebte diese wohl persönlichste und innigste Oper Janáčeks unter dem ins Femininum veränderten Titel „Die schlaue Füchsin“ ihre Erstaufführung an der Staatsoper Stuttgart. Als Begründung für diese Titeländerung führen Regie und Programmheft dieser Produktion an, dass die Füchsin keine niedliche Tierfigur, sondern eine souverän auftretende, selbstbewusste ihre Freiheit liebende Frau sei, ja, im besten Sinn eine Feministin verkörpere. Dazu ist sie ein klarer Gegenentwurf zur Welt der Menschen, insbesondere zu jener der Männer.

Die hier niedergelegten Beobachtungen und Gedanken des ioco-Redakteurs basieren auf der zweiten Aufführung am 14. 11. der Stuttgarter Oper. Die Handlung dieser Oper stammt scheinbar aus einem Märchen oder einer Fabel, ist aber tatsächlich viel mehr und vereinigt weitere Gattungen in sich: Ein Förster fängt ein ihm beim Mittagsschlaf in der Idylle des Waldes bestaunendes Fuchskind, nimmt es mit und hält es als Haustier. Während der Förster eine innige Beziehung zu dem Tier aufbaut, wird dieses von der Försterin und den Kindern des Paares abgelehnt und gequält. Dennoch oder erst recht dadurch reift es zu einer selbstbewussten und stolzen Füchsin heran, emanzipiert sich so unter den anderen Tieren auf dem Hof des Försters und träumt von Freiheit und Eigenständigkeit. Nach einer erfolglosen Rebellions- und Motivationsrede an die Hennen, sich gegen den sie beherrschenden Hahn zu wehren, richtet die Füchsin unter den Hühnern ein regelrechtes Massaker an und nutzt das daraus entstehende Chaos zur Flucht in den Wald. Dort setzt sie ihre bei den Menschen erworbenen Kenntnisse erfolgreich ein und vertreibt in einer Pose aus Stolz, Überlegenheit und Macht einen Dachs aus seinem Bau und gründet in diesem mit einem von ihrer Ausstrahlung und Biografie beeindruckten, äußerst schönen Fuchs-Mann eine Familie. Parallel zu dieser Wald-Idylle, die von allerhand anderen Tieren des Waldes und des Feldes belebt wird, blendet die Opernhandlung mehrmals in die Menschenwelt über. Dort treffen sich auch der Förster, der Lehrer und der Pfarrer beim Kartenspiel und versenken sich in ihre jeweiligen Erinnerungen und Träume. Die des Försters gelten der entlaufenen Füchsin, die der beiden anderen Männer ihrer verblassten oder erhofften Geliebten Terynka, deren Bild mehr und mehr mit dem der Füchsin verschmilzt. Diese wird indessen - nach einer provokant-feministischen Ansprache - vom aufgebrachten Wilderer Haraschta erlegt, der aus ihrem Fell einen Pelz zur Hochzeit mit seiner Verlobten – Terynka! - machen lassen möchte. Diese Terynka bleibt auch weiterhin ein Phantom, aber unsichtbares Bindeglied der Männerwelt und deren Subjekt der Sehnsucht. Der gewaltsame Tod der Füchsin führt nicht, wie aus Menschensicht vielleicht zu erwarten, zu Trauer und Niedergeschlagenheit, sondern zu dem der Natur innewohnenden neuen Aufbruch und neuem Leben. Dieses begegnet dem wieder in den Wald gekommenen Förster in einem jungen Frosch und wieder in einem kleinen Fuchs, die sich als direkte Nachfahren der Tiere aus dem Eingangsbild entpuppen. Der in einen erneuten Schlaf sinkende und dabei sein Gewehr verlierende Förster wird so zum Teil eines größeren Ganzen, „zur schöpferischen Ordnung des Lebens selbst“, wie es das exzellent gestaltete Programmheft der Stuttgarter Inszenierung beschreibt.

Das aus dem Regisseur Stephan Kimmig, der Bühnenbildnerin Katja Haß, der Kostümbildnerin Anja Rabes, dem Choreografen Jonathan Alexander Reimann und der für die Beleuchtung zuständigen Gerrit Jurda bestehende Regieteam findet für diese vielschichtige und zauberhaft verwobene Lebens- und Traumwelt plausible Formen, bestechende Symbole und ausnehmend schöne Bilder. Deren Reihe beginnt mit etlichen menschlich-tierischen Doppelbesetzungen im Bereich der Gesangsrollen, namentlich Olivia Johnson als Försterin und Eule, Moritz Kallenberg als Lehrer und Mücke, Catriona Smith als Wirtin Pasek und Eichelhäher, Itzeli del Rosario als Dackel und Specht sowie Andrew Bogard als Pfarrer und Dachs. Diese allesamt sehr sinnigen und hintergründigen Paarungen erlauben überraschende Entwicklungen und schlüssige wie originelle Parallelen, etwa wenn die Mücke des wunderbaren Tenors Moritz Kallenberg auf betörende Weise den schlafenden Förster in die Nase sticht und derselbe Darsteller später als betrunkener Lehrer über den Wirthaus-Waldboden torkelt. Auch sonst lebt diese Oper vom ständigen Wechsel zwischen Tier- und Menschenwelt, in den auch die wichtige, vom Förster verstandene und überbrachte Botschaft dieser einfühlsamen Stuttgarter Inszenierung passt, dass die Natur und das Leben sich in einem ewigen Kreislauf bewegen und schon das Leben an sich ein einziges Wunder darstellt.
Katja Haß hat für diese „Verbund-Welt“ eine aus Holz gefertigte tunnelartige und in die Tiefe der Bühne ragende Halle gebaut. Diese mag auf den ersten Blick den Naturbezug verleugnen und allzu technisch und mensch-bezogen wirken. Auf den zweiten Blick und im weiteren Verlauf der gut 90 Minuten dauernden, ohne Pause gespielten Oper ergeben sich jedoch zahlreiche inhaltliche und ikonografische Bezüge zwischen den beiden Polen Natur und menschliche Gesellschaft. Auch ermöglicht die raffinierte Konstruktion dieses Einheitsbildes mit ihren versteckten Türen, Luken und sonstigen Durchlässen recht wirksame Auf- und Abtritte, was der Aufführung einen gewissen Drive verleiht, manchen szenischen Effekt ermöglicht und die Verschränkung der verschiedenen Handlungs- und Zeitebenen weiter perfektioniert. Darüber hinaus bietet das Bühnenbild der Regie zusätzliche Möglichkeiten, die an sich schon sehr schlüssige und psychologisch spannende Personenführung nochmals zu verfeinern und erweist sich auch akustisch als vorteilhaft.

Dabei hätten die allesamt aus dem eigenen Haus - sei es dem Ensemble der Staatsoper Stuttgart oder aus deren Internationalem Opernstudio - stammenden Sängerinnen und Sänger diese architektonisch - technische Unterstützung kaum nötig gehabt. Die für eine Oper ausnehmend große Solistenschar zeigt nämlich ohne Ausnahme eine so niveauvolle, ja bravouröse musikalische Leistung, dass man kaum glauben kann, dass unter diesen wunderbaren Sänger-DarstellerInnen keine externen Kräfte zu finden sind. Neben den bereits genannten Doppelbesetzungen lebt Janáčeks Füchsin im Allgemeinen und ihre Stuttgarter Produktion im Besonderen von den Rollen der Füchsin, des Fuchses, des Wilderers Haraschta (in den Schlussbildern) und der des Försters, der mit seinen Auftritten die Oper eröffnet und beschließt. Als dieser überzeugt Paweł Konik mit seinem dunkel und fein timbrierten Bass sowohl stimmlich als auch darstellerisch und verleiht dieser ambivalenten Rolle eine sehr glaubhafte und auch in ihrer Entwicklung äußerst nachvollziehbare Realitätsnähe. Ein ebenso passendes wie überzeugendes Profil verleiht Michael Nagl dem Wilderer, dem man abnimmt, dass er an die Existenz und Liebe der von ihm begehrten Terynka glaubt. Von großer Liebe zur Partnerin, in diesem Fall zur Füchsin, zeugt auch die wunderbare Ida Ränzlov als Fuchs, die ihre Szenen mit der ihn verführenden Füchsin zu einigen der optisch-szenischen und auch musikalischen Höhepunkte dieser Aufführung macht. Die grandiose Sopranistin Claudia Muschio ist nicht nur in diesen Momenten eine kongeniale Partnerin, nein, als Füchsin ist sie der Dreh- und Angelpunkt von Janáčeks siebter Oper und der absolute Star von deren Stuttgarter Inszenierung. Wie sie die Bewegungen des Tieres verinnerlicht und geschmeidig auf die Bühnenbretter bringt, ist genauso ein Ereignis wie ihre weitere darstellerische Finesse und erst recht ihre ungeheure stimmliche Präsenz und Dynamik.
An diese beeindruckenden Einzelleistungen knüpfen jene der beiden in dieser Oper geforderten Vokalensembles, beide unter der Leitung Bernhard Moncados, lückenlos an. Da wäre als erstes der Kinderchor der Staatsoper zu nennen, der an mehreren Stellen der Opernhandlung Buntheit einhaucht und für Schwung und junges, fetziges Leben sorgt. Mit der betörenden Martha Pfeifer als Jungfuchs und Nura Pilz als junger Frosch sowie Simon Musienko und Alissa Kruglyakova als Kinder des Försters stellt der Kinderchor außerdem vier liebreizende wie präsente junge Solisten. Sehr überzeugend agiert auch der „Erwachsenenchor“ der Staatsoper, dessen Damen in der Hühnerszene im ersten Akt außerdem eine mitreißende sprachlich-darstellerische Einlage liefern.

Was an der Aufzählung und Würdigung des Musikalischen noch fehlt, ist das Staatsorchester Stuttgart, dem an diesem Abend bzw. in dieser Oper eine ganz besondere Rolle zukommt: Die wesentlichen Aussagen dieser Oper werden nämlich nicht in den Dialogen von den auf der Bühne Agierenden geäußert, sondern sind in der klangseligen und fantasievollen Musik Janáčeks verborgen. Diese wird vom Staatsorchester Stuttgart unter der feinfühligen und klugen Leitung der französischen Dirigentin Ariane Matiakh sehr sinnenhaft, farbenreich, fein schwebend und locker oszillierend musiziert. So lässt sich jederzeit hören, wie sich die überlagernden Klang- und Themenwelten auf beinahe wundersame Weise durchdringen und vermischen. An manchen Stellen fetzt und groovt das Orchester regelrecht und bereichert die Szenen mit feinster und äußerst bildhafter Lautmalerei. So erfreut sich Ohr und Herz an böhmisch-mährischen Weisen in volksliedhaftem Ton genauso wie am Summen und Flirren von Insekten und Vögeln in den anheimelnden Waldszenen.
Und was die Bläser, insbesondere jene im Blech, an diesem Abend von sich geben, steigert den akustischen Wohlgenuss fast ins Märchenhafte.
Als Resümee kann festgehalten werden, dass Janáčeks Füchsin, als Werk wie als dessen Titelheldin, die große Lebendigkeit und Lebensfreude widerspiegelt, die in Umwelt und Natur vorhanden sind. Die Natur umgibt hier alles, und Menschen und Natur sind keine getrennten Welten. Diese Stuttgarter Inszenierung kann dabei helfen, sich dieses Wunders des Lebens bewusst zu werden, wobei dies ganz besonders und auf besonders wunderbare Weise für die Musik gilt. Sie setzt oft genau da ein, wo das menschliche Bewusstsein an seine Grenzen stößt.
Dass diese Naturwelt aber keine Idylle ist, sondern bedroht und beschädigt wird, machen die vertrockneten, kahlen Bäume hinter der Glasscheibe am Ende des Bühnenbild-Tunnels deutlich. Mitten in der Klimakonferenz COP 30 in Brasilien kann das an das Stuttgarter Opernpublikum ein Appell sein, diese Natur zu schützen und sich mit ihr zu versöhnen.
Weitere Vorstellungen am 23. und 26. November sowie am 10. Dezember