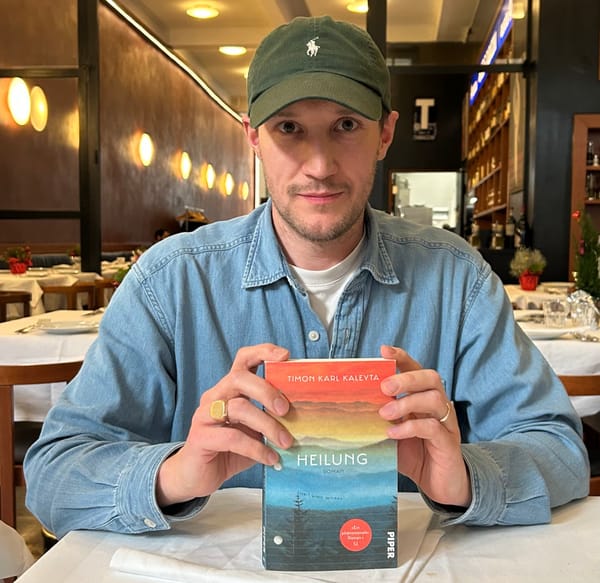Strasbourg, Opéra national du Rhin, Otello - G. Verdi, IOCO

31.10.2025
DIE LOGIK DER WUT UND DES WAHNSINNS…
Credo in un Dio crudel
Che m’ha creato simile a sé
E che nell’ira io nomo.
Dalla viltà d’un germe
O d’un atòmo vile son nato.
Son scellerato perché son uomo,
e sento il fango originario in me.
Si! Quest’è la mia fè!
(Credo des Jago (Auszug)
Der Sturm der Leidenschaft…
Diese Abhandlung soll gleichzeitig eine Lobeshymne sein – daher der Titel -, und eine Art von Meditation seitens eines Menschen sein, der fest an den tiefen Reichtum der italienischen Musik und die Universalität ihres musikalischen Vokabulars glaubt.

Unweigerlich stellen die beiden Opern Otello (1887) und Falstaff (1893) von Giuseppe Verdi (1813-1901) zusammen ein Kulturdenkmal dar, die Krönung des Werkes des größten Genies der italienischen Musik des 19. Jahrhunderts, den Höhepunkt der italienischen Oper. Mehr als hundert Jahre später wurde allen Kennern des italienischen Repertoires klar, dass diese beiden Werke den logischen Abschluss einer fünfzigjährigen Entwicklung der Kunst von Verdi darstellen. Ihre makellose Perfektion führte die italienische Lyrik in eine ähnliche Sackgasse, wie sie Tristan und Isolde (1865) von Richard Wagner (1813-1883) im deutschsprachigen Raum auslöste. Der Mann, der persönlich die Form des bel canto in all seiner Eleganz, Schönheit und Raffinesse erhalten hatte, der Erbe von Gioachino Rossini (1792-1868), Vincenzo Bellini (1801-1835) und Gaetano Donizetti (1797-1848) machte sich daran, die italienische Oper nach und nach zu reformieren und sie so von den statischen Formen des frühen 19. Jahrhunderts sowie von der Vorherrschaft des Gesangs – oft seiner missbräuchlichen Hegemonie – und von der Tyrannei der prima donna zu befreien. Verdis unermüdliche Suche nach theatralischen Materialien, musikalischen und dramatischen Werten, sein Umgang mit dem Orchester, der ihn von der einfachen Rolle des Begleiters befreit, seine unermessliche und vorurteilsfreie Menschlichkeit, alles scheint in diesen beiden Meisterwerken zu gipfeln, deren Größe Kenner der italienischen Musik und Liebhaber der italienischen Oper ohne Schwierigkeiten erkennen können. Ist es nicht immer noch aufschlussreich, dass für viele Musikliebhaber, die die italienische Oper mit Herablassung betrachten, das aber diese beiden späten Werke von Verdi eine Ausnahme bei ihnen machen?

Genau auf diesen Punkt möchten wir unsere Aufmerksamkeit richten! Wir denken, dass Otello und Falstaff, wie so viele großartige Werke, einen unmittelbaren Eindruck hinterlassen und in keiner Weise nähere Vorkenntnisse des Komponisten erfordern. Denn wenn man sie mit einem anderen Horizont im Hintergrund betrachtet, kommt ihre wahre Bedeutung und Genialität natürlich klarer zum Vorschein. Wir erinnern uns noch genau, als wir die Oper zum ersten Mal hörten, als wir gerade dreizehn waren! Obwohl wir kaum Italienisch verstanden und unsere Ausbildung noch lange nicht abgeschlossen war, waren wir dennoch von der unglaublichen Kraft dieser Musik fasziniert. Und auch heute noch, nach so vielen Jahren, erstaunen wir immer noch über jedes einzelne Element ihrer Struktur!
Falstaff im Gegenteil von Otello, ist ein Werk voller Referenzen, reich an ironischen Anspielungen, an Parallelen, Selbstzitaten, Anspielungen auf andere Werke, voller Humor und Ironie. Es erreicht seinen Höhepunkt mit dieser berühmten Arie: „Tutto nel mondo é burla“, das der alte Verdi auf sich und seine Werke anwendet. Falstaff ist harmonisch und fröhlich und dennoch voller tragischer Untertöne – auf diese Weise ein enger Verwandter des klassischen tragischen Stils von Otello.

Falstaff ist ein letzter Rückblick, von dem aus alle bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gesammelten Kräfte strahlen. Der Wert von Werken wird oft an ihrem innovativen Charakter gemessen! Es ist bemerkenswert, dass Otello und Falstaff – die unserer Meinung nach eher Teil einer logischen Kontinuität als eine Innovation darstellen – in den internationalen Ruhm aufgenommen wurden, während so viele der frühen Werke von Verdi – die wahrhaft revolutionär waren – in den Hintergrund gedrängt wurden. So war es Verdi, der 1847 in Florenz als erster ein Drama von William Shakespeare (1564-1616) auf einer italienischen Bühne präsentierte, während der Autor von Hamlet (1603) in Italien noch nie zuvor aufgeführt worden war. Er war es, der in seinen frühen Werken ein politisches Engagement zum Ausdruck brachte, das bis dahin kein anderer Komponist zu vermitteln vermochte. Er, der in seinen frühen und schon sehr reifen Werke großen Mut bewies, indem er in seinen Opern ungewöhnliche Charaktere, Antihelden präsentierte, nämlich Zigeuner, einen buckligen und verbitterten Hofnarr oder eine Kurtisane auf der Bühne zeigte: Il Trovatore (1853), Rigoletto (1851), La Traviata (1856)… Er bestand darauf, seine eigenen Verzierungen und Kadenzen zu schreiben, um zu verhindern, dass die Sänger die Gesangslinie mit unpassenden Schnörkeln verschönerten, nur um diese ausdrucksstarken Merkmale schließlich aus seinem Vokabular zu streichen. Er perfektionierte die Form der scena ed aria, die cabaletta oder die des Orchesterprologs und lehnte sie alle als Finale ab. Er brachte das politische Drama auf die Bühne: Les Vêpres siciliennes (1855), Don Carlo (1867), Simon Boccanegra (1857) und er experimentierte mit dem epischen Drama La Forza del Destino (1862). Schließlich gab er allmählich die geschlossene Form zugunsten einer ununterbrochenen dramatischen Bewegung auf und stellte die musikalische Substanz in den Vordergrund, was ihm erlaubte, einen Gesangsstil zu perfektionieren, der sowohl Gesang als auch Deklamation vereinte. All dies findet seine Erfüllung in Otello und Falstaff.

Die drei Protagonisten von Otello können als Äußerlichkeiten von drei Elementen betrachtet werden, die gleichermaßen in jedem von uns vorhanden sind: Das Selbst als kreativer Held, die zerstörerische dunkle Seite, die in ihm lebt und die andere die ihn idealisiert. Die Triade Otello – Jago – Desdemona entspricht in diesem Sinne der Konstellation des Faust (1774) von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): Faust – Mephisto – Gretchen. Die Tragödie von Otello besteht im Wesentlichen darin, dass er sein eigenes Bild vom „Helden“ ohne die Projektion dieses Bildes, das von „Desdemona idealisierten“, das für ihn wie ein Spiegel funktioniert, nicht aufrechterhalten kann. Diese Schwäche ermöglicht es dem destruktiven Element „Jago“ zu triumphieren!
Verdi wollte seine Oper zunächst Jago nennen! Wie Wystan Hugh Auden (1907-1973) in seinem außergewöhnlichen Aufsatz über den Otello (1604) von Shakespeare schrieb: „Jede Untersuchung von Otello muss sich vor allem nicht mit seinem offiziellen Helden befassen, sondern mit dem Schurken, den er darstellt… Alle Handlungen beginnen mit nur einer Figur – alle Aktionen werden von Jago ausgeführt und alle anderen handeln ausnahmslos nur durch Reaktion“.
Als grundsätzlich böses Wesen findet Jago zwar kein Gegenstück, dafür aber viele Vorläufer. Diese „unmotivierte Schurkerei“, so Samuel Tayler Coleridges (1772-1834) berühmte Charakterisierung, unterscheidet ihn von den meisten Schurken! Er verkörpert im Alleingang die gesamte Boshaftigkeit des Bass-Baritons der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts und was von diesen Figuren noch bleibt, ist sicherlich schwarz, aber doch in der Lage etwas Sympathie in uns zu erregen: Nabucco (1842) ,Rigoletto, Macbeth (1847), Renato aus Un ballo in maschera (1859), Germont aus La Traviata haben diese Charaktere, in denen wir wenig kompensatorische Tugenden finden. Silva aus Ernani (1844), Wurm aus Luisa Miller (1849), Luna aus Il Trovatore, Don Carlo aus La Forza del Destino, Amonasro aus Aida (1871) und der Paolo aus Simon Boccanegra war der vorletzte Schritt vor dem absoluten Bösen, das Jago verkörpern wird. Als Verkörperung weiblicher Güte und Mitgefühl ist Desdemona, eine Nachkommin der gesamten Verdi-Galerie von Sopranistinnen: Elvira aus Ernani, Luisa Miller, Gilda aus Rigoletto, die Leonora aus Il Trovatore und aus La Forza in maschera, Amelia aus Un ballo in maschera, Elisabetta aus Don Carlo, Elvira aus Ernani, Aida und die Sopranistin aus dem Messa da Requiem (1874), aber sie ist hier eher ein Opfer denn eine mutige Heldin.

Umgekehrt die Zahl der Otellos, die am meisten die patentierte Innovation darstellen, einen Tenor die Rolle des Liebhabers anzuvertrauen, ist keine Neuheit – aber einen Liebhaber in der Blüte seines Lebens von einem Tenor gesungen zu werden, ist wohl einzigartig. Otello ist Verdis letzte heroische Tenorrolle – sein einziger Nachfolger wird im völligen Gegensatz ein Tenor lirico leggero sein: Fenton, der liebevoll seine Stimme mit der von Nanette im Falstaff vermischt hat, der letzten Hommage des Komponisten an seine Jugend. Für poetische Tenöre, Liebespaare, Militärhelden gibt es Vorbilder – aber kein einziges für den tragischen Helden. Es ist bemerkenswert, dass bei so vielen Verdi-Tenören, die zumeist jung und ungestüm sind, die Jugend als Ausreden für ihre Leidenschaften und Exzesse dient. Von Manrico aus Il Trovatore bis Don Carlo, von Alfredo aus La Traviata bis Radames aus Aida – jeder Mensch verkörpert auf seine Weise eine bestimmte Tugend, die durch Leidenschaft verloren geht. Nur Don Alvaro und Riccardo weisen in dieser Hinsicht einen ausgeprägteren geistigen Adel auf. Die Verwendung eines Tenor spinto für einen tragischen Helden, der von Fehlern geplagt ist, ist eine Besonderheit im Werk von Verdi – ein bel canto spinto ist fast ein Oxymoron, mit Ausnahme von Pollione aus Norma (1831) von Bellini, da die spinto Tenöre in der veristischen Lage nicht als tragische Helden betrachtet werden können.
Kommen wir zur Bereicherung der Rolle des Orchesters und der symphonischen Entwicklung in Otello und Falstaff, die Ludwig van Beethoven (1770-1827) viel zu verdanken hat, aber auch Wagner – sein Einfluss ist weiterhin ein ungelöster Diskussionspunkt -, aber auch dem wachsenden Interesse an der Instrumental-Musik in Italien. Nach Un ballo in maschera machte jede seiner Opern, einschließlich der überarbeiteten Fassungen von Macbeth und Simon Boccanegra, spektakuläre Fortschritte in dieser Richtung. Das Orchester in Otello hat bereits die beschreibende Kraft, wie z. B. der Fontainebleau-Akt, das schottische Moor – wie auch der überarbeiteten Fassung -, der Szene des Ratssaals in Genua, dass alten Ägypten und die Dies Irea. Andererseits geht die Orchestrierung – um nur einige Beispiele zu nennen – der Szene des Sturms und das Liebesduett im ersten Akt, der Huldigungs-Chors der Cyprioten, das Duett des Schwurs von Otello und Jago, die Weiden-Arie und das Ave Maria, das Kontrabass-Solo im vierten Akt nichts anderes voraus. Und von all diesen Passagen wird vielleicht nur das Trio des dritten Akt das Ausmaß des riesigen Schritts zeigen, die durch die Orchestrierung von Falstaff endlich vollbracht wird.

Es folgt in den von Thomas Stearms Eliot (1888-1965) definierten Kriterien, um ein klassisches Werk zu charakterisieren: Reife des Geistes, der Sprache und des Ausdrucks. „Ein Klassiker kann nur in einer Zivilisation entstehen, die ihre Reife erreicht hat. Ein isolierter Künstler, der einen reifen Geist für sich hat, lebt vielleicht in einer weniger ausgereiften Ära“ – in dem Sinne, in dem Eliot es bedeutet, wir denken so an Claudio Monteverdi (1567-1643) oder Rossini -, „damit seine Arbeit weniger Reife aufweist“. In einem anderen Sinne könnte man das Libretto als klassisch bezeichnen. Die Zusammenarbeit zwischen Verdi und Arrigo Boito (1842-1918) könnte zu Recht als ebenso vorbildlich beurteilt werden wie die von Mozart und Lorenzo Da Ponte (1749-1838) oder die von Richard Strauss (1864-1949) mit Hugo von Hofmannsthal (1874-1929). Wie Julian Budden (1924-2007), der Biograph von Verdi es ausdrücken konnte, verbannte Boito die Tyrannei von Metrum und Formen. Verdi wollte den Komponisten von den starren Regeln der Poesie befreien und stattdessen eine dem Theater entsprechende Unmittelbarkeit anstreben. Er nannte es la parola evidente e scenica – „das klare und szenisch wirksame Wort“. Otello verdankt seine ununterbrochene Kontinuität der unglaublichen Fähigkeit von Verdi, unmerklich von einer Idee zur nächsten zu wechseln.
Und doch muss man feststellen: Es ist immer der Komponist, der als Musiker – wie genial sein dramatischer Instinkt auch sein mag – für die Nachwelt seines Werkes sorgt. Wie der Musikwissenschaftler Paul Robinson (*1979) in seinem Artikel Reading libretti and misreading opera schreibt: „Eine Oper kann nicht aus ihrem Libretto gelesen oder verstanden werden, denn im Grunde ist die Bedeutung der Oper in einer musikalischen Sprache formuliert. Jede Interpretation einer Oper, die ausschließlich oder sogar hauptsächlich sich auf das Libretto stützt, wird wahrscheinlich als Fehlinterpretation enden“. Auch wenn Boitos Texte als Höhepunkt der italienischen Libretto-Kunst gelten, hat keines seiner Librettos jemals einer Oper erlaubt, ihre musikalischen Schwächen zu überwinden, auch nicht seinen eigenen Opern. „Große Musik ist Musik, die besser sein kann als die Art und Weise, wie sie jemals gespielt werden kann“, sagte Arthur Schnabel (1882-1951). Andererseits bedeutet dies auch, wie Bryan Magee (1930-2019) bemerkte, dass man die widersprüchlichen Interpretationen kennenlernen könnte, die ihnen zuteilwerden, indem jede die Notwendigkeit einer anderen erklärt. Doch Magee meint: „Da wir unterschiedliche Interpretationen brauchen, müssen wir immer offen für neue Herangehensweisen an Kunstwerke sein. Unser Blick darf sich nie verhärten. Mit einer Interpretationswahl muss sich eine andere zwingend ausschließen“. Um Schnabel zu paraphrasieren: Das Charakteristische jedes großen Werks ist, dass seine Unsterblichkeit nicht von seinen Interpreten abhängt: Sie ist mehr als die Summe seiner Interpretation! Der bekannte Musik-Lehrer Jean Morel (1913-1975) pflegte zu sagen, musikalische Meisterwerke seien wie große ehrwürdige Eichen: Man könne sie treten und mit ihnen machen, was man wolle und sie würden trotzdem stehen bleiben. Gott sein Dank! Meisterwerke sind bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sich entscheidet, sie aufzuführen in gewisser Weise beeinträchtigt. Wie Eliots klassisches Werk, Morels Eiche und Schnabels Meisterwerk ist Otello eine so perfekte Oper, dass sie alle interpretatorischen Mängel mit unverminderter Erhabenheit übersteht. Dieses Werk ist so vollendet, es zeugt von solcher Meisterschaft, dass es nie an Kraft verliert. Keine einzige Note ist überflüssig. Für Interpret und Zuschauer ist es ein wahres Privileg, eine Aufführung von Otello gemeinsam zu erleben. Für jeden Interpreten ist es eine große Freude, dieses Werk in seiner ganzen Tiefe zu erkennen.

Die Aufführung in der Opéra National du Rhin / Strasbourg am 31.10.2025:
OTELLO und seine eifersüchtige Macht…
VERDIS düsterste Oper wird von der OPÉRA NATIONAL DU RHIN in einem filmischen Schwarz-Weiß-Stil mit HITCHCOCK-artiger Spannung inszeniert. Für Emotionen bleibt leider kein Raum…
Zugleich mit der Bekanntgabe des amerikanischen Regisseur und Autor Ted Hufman zur Ernennung als Leiter des Festivals von Aix-en-Provence, feierte seine neue Inszenierung von Otello in Strasbourg - an einem der Spielorte der Opéra National du Rhin -, Premiere! Der junge New Yorker, ein Liebling der internationalen Opernszene, der in Aix-en-Provence die schwierige Aufgabe übernimmt, die Nachfolge des verstorbenen und außergewöhnlichen schillernden Pierre Audi (1957-2025) anzutreten, enttäuschte unserer Meinung leider sehr mit seiner Otello -Inszenierung. Zuvor hatte er beim Festival Aix-en-Provence seine umjubelte Inszenierung von Monteverdis L’incoronazione di Poppea, SV 308 (1642) im Sommer 2022. Und auch die fast vergessene Oper Die Vögel (1920) von Walter Braunfels (1882-1954) wurde an diesem Haus von Huffman inszeniert und wiederaufgeführt. Er arbeitet immer nach dem Prinzip, dass die Verbale, musikalische und gestische Erzählung in sich schlüssig sein muss: Ohne durch Bühnenbild und Szenografie verstärkt zu werden! Gemäß diesem maximalistischen Prinzip hat jegliches Lokalkolorit, so künstlerisch es auch sein mag, auf der Bühne nichts zu suchen. So findet sich in diesem Otello, der 1887 am Teatro alla Scala in Mailand entstand, keine Spur des Zypern des 16. Jahrhunderts, dem Schauplatz der Oper, die von Shakespeares gleichnamiger Tragödie inspiriert wurde. Nach einer sechzehnjährigen Schaffungspause infolge des immensen Erfolgs von Aida widmete sich der Mailänder Komponist zusammen mit seinem Librettisten Boito einem musikalischen Drama von extremer Intensität, dessen Crescendo unaufhaltsam zum Tode führt.
Der Mohr von Venedig…
Im Mittelpunkt der Handlung steht der Kapitän der venezianischen Flotte, der Mohr Otello - man sollte
Bedenken, dass „Mohr“ damals auch eine Person of Color bezeichnete -. Er hat soeben die türkischen Streitkräfte besiegt und damit die unangefochtene Vorherrschaft der Republik Venedig im östlichen Mittelmeer gesichert. Alles scheint für Otello nach Plan zu laufen, er ist glücklich mit der schönen und reinen Desdemona verheiratet, wären da nicht die vielen Intrigen seines Fähnrichs Jago, der dieses unbestreitbare Glück zerstören will und geschickt mit Eifersucht in Otellos verletzlichem Herzen Zwietracht säen will. Er hat unerwartet großen Erfolg und die Affäre endet in einem Blutbad!
Als sich der Vorhang hebt, ist weder der Hafen von Famagusta noch ein Segel zu sehen, während der Chor singt. Wir befinden uns auf einer hermetisch abgeschlossenen Bühne, einem flachen Rechteck, umschlossen von hohen Mauern mit vier Öffnungen für Ein- und Ausgänge. Lediglich die unterschiedliche Anordnung von Tischen und Stühlen signalisiert die Ortswechsel in den vier Akten. Diese vermeintliche Kargheit, die die Strenge elisabethanischer Szenen evozieren soll, versteht der Regisseur als ein Drama hinter verschlossenen Türen, in dem sich die Intrigen der mediterranen Gesellschaft der 1950er Jahre entfalten. Konnte. Übrigens ist Huffman auch für das Dekor verantwortlich!
Ein brennendes Klima…
Hinter dem Glanz und der oberflächlichen Anständigkeit brechen urtümliche Triebe hervor. Männer beherrschen nach wie vor ein streng reglementiertes Gesellschaftsleben, in dem allgegenwärtige Hitze, Gewalt, Frauenfeindlichkeit, Ehrgeiz und der latente Rassismus – gegenüber dem Mohren Otello , der in eine verletzliche Lage gerät und dem manipulativen Jago zur leichten Beute wird – eine erdrückende, explosive Atmosphäre schaffen, die zum Mord an Desdemona führt. Doch dieser Femizid wird auf sehr „saubere“ Weise ausgeführt: Nicht durch Strangulation im Schlafzimmer des Paares, wie im Libretto vorgesehen, sondern mit einem Revolver in der Halle, in der das letzte Festmahl stattfand. Das hochgradig filmische Spektakel erzeugt eine spürbare Spannung, insbesondere durch die Musik, die an Alfred Hitchcocks (1899-1980) Film Dial M for Murder (1954) erinnert.
Das Problem dieser Inszenierungsart liegt in ihrer Vorgefertigtheit, die sich auf jede beliebige Situation anwenden lässt und auch wenig Raum für Emotionen lässt. Verschärft wird dies durch die eher oberflächliche Regie der Schauspieler/Sänger. Als mildernder Umstand hatte Huffman sein Projekt mit dem afroamerikanischen Tenor Issacha Savage entwickelt, der nicht nur mit der Rolle bestens vertraut war, sondern auch ausgewählt worden war, um den Rassismus, dem der Mohr Otello ausgesetzt war, hervorzuheben. Der Tenor musste jedoch in letzter Minute absagen und die Rolle übernahm der georgische Tenor Mikheil Sheshaberidze. Da Blackfacing für Sänger heute stillschweigend verboten ist, bricht ein ganzer Aspekt der psychologischen Analyse weg.
Realistisch und symbolisch…
In einer passenden Wendung der Ereignisse sind in diesem Opernhaus, in dem üblicherweise Männer die Fäden ziehen, hier in Strasbourg die Frauen die unbestrittenen Stars des Ensembles. Dies gilt auch insbesondere für die italienische Dirigentin Speranza Scappucci, die bei dem ebenfalls italienischen Dirigenten Ricardo Muti wohl alles von ihm erlernte. Ihre Energie sprüht vom ersten Ton der Oper an, die ohne Prolog beginnt, sondern im Allegro agitato mit einem donnernden Knall einsetzt und so einen furchterregenden Sturm ankündigt, der sowohl real als auch symbolisch ist. Die Dirigentin versteht es zudem, diese vielen ungeahnten Nuancen dieser schon sehr modernen Partitur mit innovativen und hochkomplexen Orchestrierungstechniken herauszuarbeitete. Unter ihrem Taktstock begleitet die Musik nicht einfach den Gesang, sondern spielt eine eigenständige Rolle im Drama! Das Orchestre Philharmonique de Strasbourg erweist sich als bemerkenswert reaktionsschnell, wie der grandiose Orchesterprolog zu Beginn des vierten und letzten Akts beweist. Hervorzuheben ist auch die extraordinäre Leitung des Choeur de l’Opéra National de Strasbourg des französische Chorleiters Hendrik Haas, der gemeinsam mit dem Choeur de l’Opéra National de Nancy-Lorraine mit ihrem ebenfalls französischen Chorleiters Christophe Talmont zusammen wirkt. Das Ensemble bildet eine imposante Gesangs- und Bühnenpräsenz, die mit viel unendlicher Finesse geführt wird.
Die zweite grosse Gewinnerin des Abends war wohl die französische-guatemaltekische Sopranistin Adriana Gonzàles, die eine zutiefst bewegende Desdemona verkörperte. Mit unbestreitbarer Stimmkraft und wunderschönem Legato glänzte die Sängerin zudem mit feinfühligen Pianissimo und lang gehaltenen hohen Tönen. Dies zeigte sich besonders im vierten Akt, als ihr Schicksal unausweichlich erschien, im „Weidenlied“ und ganz besonders in dem bravourösen Stück, das den erfahrensten Stimmen vorbehalten sind: Ihrem absolut atemberaubenden „Ave Marie“. Durch sie erreichte die lang ersehnte Emotion endlich ihren Höhepunkt!
Die männlichen Darsteller, deutlich schwächer besetzt, können weder überzeugen noch die dramatische Handlung glaubwürdig wirken lassen. Der Tenor Sheshaberidze, dessen größtes Verdienst wohl darin besteht, kurzfristig für die anspruchsvolle Rolle des Otello eingesprungen zu sein – eines leidenden Wesens, dessen Leiden sich nach und nach in seiner ganzen Brutalität entfaltet, mit unterschiedlichem Erfolg je nach seines unendlichen langem Abstiegs in die Hölle -, soll hier nicht weiter erwähnt werden. Dem polnischen Bariton Daniel Miroslaw als Jago mangelt es zwar nicht an Eleganz, doch fehlt ihm die Nuance, die der „grünäugigen Schlange“ gebührt. Doch von allen männlichen Rollen überzeugt letztendlich der spanische Tenor Joel Priet als Hauptmann Cassio, das leichte Opfer, auf das sich Otellos Eifersucht richtet, am meisten.
Dieser an Höhepunkten sehr armen Produktion hat natürlich keinerlei Begeisterung in uns geweckt, sie wird unweigerlich sehr bald aus unserem Gedächtnis verschwinden.