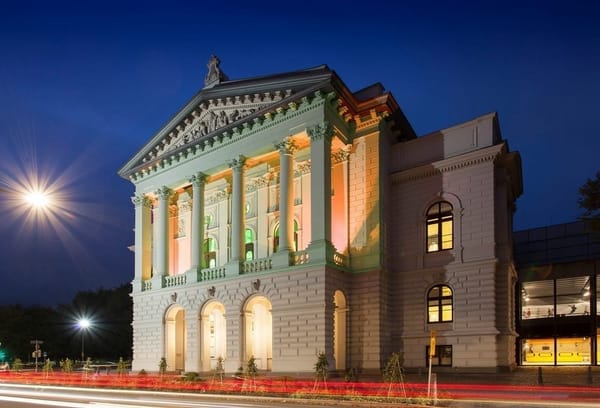Paris, Opéra Bastille, Aida - G. Verdi, IOCO

07.10.2025
EUROPAS BEGEGNUNG MIT ÄGYPTEN…
L’aborrita rivale a me sfuggias…
Dai Sacerdoti Radamès attende
Dei traditor la pena, Traditore
Egli non è… Pur rivelò di guerra
L’aito segreto… egli fuggir volea…
Con lai fuggire… Traditori tutti!
A morte! A morte!… Oh! Che mai parlo? Io l’amo,
lo l’amo sempre… Disperato, insano
è quest’amor che la mia vita strugge.
Oh! s’ei potesse amarmi!
Vorrei salvarlo, E come?
Si tenti! Guardie: Radamès qui venga.
(Szene der Amneris / 4. Akt)
Die Ägyptomanie von Herodot bis Mariette…
Die Ehrfurcht vor der Autorität des berühmten französischen Ägyptologen und Archäologen Auguste Mariette (1821-1881) – er hatte vor der Abfassung des ersten Aida-Szenarium das halbe antike Ägypten ausgegraben – hat in der langen Rezeptionsgeschichte von Giuseppe Verdis (1813-1901) spätem Meisterwerk fast nie die Frage nach dem literarischen und dramaturgischen Qualität des Stoffes aufkommen lassen, die naheliegende Frage, ob es sich hier tatsächlich um einen wissenschaftlich und philologisch fundierten Einblick in Sozialstrukturen der Antike handelt oder nur um eine typische romantische Dreiecks-Liebes-Geschichte im zeitgemäßen antikisierenden Dekoren: Allein der Berliner Opernzyniker Oskar Bie (1864-1938) stufte den Text schon vor einem Dreivierteljahrhundert als „Primaner-Arbeit“ ein, vermisste in ihm „jede seelische Vertiefung“, „jede dramatische Doppelseitigkeit“ und rügte das “primitive Nebeneinander von Szenen“. Schon vor ihm hatte der nicht weniger gefürchtete Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick (1825-1904) die „beiden Grundgebrechen“ des Textbuches getadelt: „Nach Innen die fast ununterbrochene Elegik der Handlung, nach Außen das egyptische Costüm im weitesten Sinne des Wortes“. Doch gerade diese Kostüme, also der entfesselte Monumentalismus der Szenerie, die Massenstatisterie, die Triumphmärsche, Militärparaden und geschichtsträchtigen Schauplätze, hatte das in jener Zeit im kollektiven Rausch nationalistischer Hochstimmung befindliche Publikum von Anfang an begeistert und dieser wahrlich überwältigenden Wirkung der Szenerie konnte selbst die bittere Erfahrung zweier Weltkriege nichts anhaben.

Im Gegenteil: Die Tradition der berühmten Veroneser Freilicht-Aufführungen seit 1913 hat die Oper vollends zum puren Ausstattungsspektakel und zur grellen Fremdenverkehrsattraktion verkommen lassen, der man bestenfalls noch die Vorläuferschaft zum monumentalen Historien-Schinken „Made in Hollywood“ zubilligt. Das lyrische Innenleben der Oper, wie auch die zahllosen Feinheiten der Partitur von Verdi, sind indes längst der primitiven Aufmarsch-Ästhetik geopfert worden. Ebenso unterbelichtet blieb die ganze Zeit über Verdis subtile Sozialkritik an der menschenverachtenden altägyptischen Gesellschaft, die er freilich eher musikalisch – in der Analyse der komplexen Gefühlsregung aller Betroffenen – zum Ausdruck brachte. Die eigentliche Qualität der Oper besteht ja in der szenischen varietà, der kontrastreichen Vielfalt von Situationen und Szenentypen, die man vorher in einer solchen Kombination von Extremen in keiner Oper – ausgenommen Verdis La forza del destino (1862) – gesehen hatte. In Aida stehen Szenen von zartester Innerlichkeit und Entrücktheit, wie die Romanzen des Radames und Aida im 1. Akt, das Liebesduett im 3. Akt, oder das Schlussduett im 4. Akt neben den monumentalen Staatsaktionen des 1. Bildes zu Beginn des 3. Aktes. „Die Topographie der Oper ist bedeutungsvoll“, schreibt der deutsche Musikwissenschaftler Wolfgang Schreiber (*1939), „die Schauplätze umschreiben insgesamt den Gang einer Bewegung von außen nach innen, zugleich einer fortschreitenden Entmaterialisierung. Das führt von der massenhaft, niederdrückenden ägyptischen Stadtarchitektur von Memphis mit ihren steinernen Palästen, Tempeln und Toren hinaus zum Triumphfeld Thebens, sodann zum freien Nil-Ufer, von dort in Aidas Kopf zur glänzenden Ferne eines als Fata Morgana schimmernden Traumlandes Äthiopien. Der nächste Ort ist der entleerte Fluchtpunkt der Liebenden, dem keine reale Lokalität mehr entspricht: Radames singt von „unendlichen Wüsten“, beide phantasieren von den „Sternen über uns“. Das Schlussbild des 4. Aktes ist rein halluzinatorisch, horizontal geteilt: Oben der Tempel des Vulkans, „voll Gold und Licht“, unten ein unterirdisches Gewölbe, das den Liebenden zum Grab wird und über dem sich ihnen schließlich der Himmel, als letzter Zufluchtsort des auf Erden verwehrten Glücks, öffnet“.

So besehen markiert Aida womöglich doch eine Wende in der bis dahin eher optimistisch-rebellischen politischen Grundeinstellung Verdis. Eine spürbare Resignation und Abgeklärtheit tritt an die Stelle des leidenschaftlich-aufbegehrenden und kämpferischen Tons, mit dem Verdi vorher, in mehr als zwanzig Opern seine Helden ausstattete, auch wenn sie schon damals zum Scheitern verurteilt waren. In Aida lastet die Todessehnsucht und Schicksalsergebenheit des tragischen Liebespaares von Anfang an wie ein dunkler Schatten über dem Geschehen. In den früheren Opern Verdis kämpfen die Betroffenen so lange mit allen Mitteln gegen ihr Schicksal an, bis sie der Tod eines Besseren belehrt: In Aida ist die Titelgestalt schon am Ende des 1. Bildes bereit zu sterben. Und sie behält recht! Denn schon beim ersten Zusammentreffen der drei Hauptfiguren im Terzett des 1. Akt wird uns ihr Konflikt in seinem ganzen Ausmaß vorgeführt – als unlösbarer Zustand. Und alle weiteren Auseinandersetzungen im Verlauf der Oper sind nur effektvolle Variationen desselben tragischen Grundkonflikts. Selbst der spektakuläre Opfertod Aidas und Radames‘ – der bezeichnenderweise erst nach seiner „Entehrung“ nicht mehr leben will – löst den Konflikt nicht, sondern entzieht ihm nur seine reale Basis. Deshalb bedeutet auch die eindrucksvolle „Pace, pace “- Schlussgeste der verschmähten Königstochter Amneris nicht die Lösung des Konflikts: Es ist nur eine Absichtserklärung, die Selbstbeschwichtigung einer schuldig Gewordenen, die allein mit ihrem Gewissen in der Welt zurückbleibt.
Aida – als Manifestation eines inneren Umschwungs beim alternden Verdi, als Metapher und Vorahnung politischer Entwicklungen in Europa, die den ursprünglich freiheitlichen Grundgedanken nationaler Autonomie in eine nationalistisch-reaktionäre Ideologie ummünzen und in den Terror einer fehlgeleiteten Mehrheit münden lassen würden: Diesen pessimistischen und doch wieder aufklärerischen Kern des Aida-Stoffes versuchte 1981 auch der deutsch Regisseur Hans Neuenfels (1941-2022) in seiner Frankfurter Inszenierung, freilich mit überaus forcierten szenischen Mitteln, herauszuschälen. Für Neuenfels ist Verdis Ägypten „eine Metapher der Resignation, gewiss kein Dekor; aber eine Metapher, die von der Gesellschaft fehlinterpretiert wurde. Für diese Gesellschaft war Ägypten eher eine Metapher für die Pariser Weltausstellung… Der Traum von einem dreitausendjährigen Reich ist schon faszinierend, gerade in einer Zeit der Reichsgründungen – deutsches Kaiserreich, Französische Republik, Italien“.
Vielleicht hat Verdi die Faszination des Monumentalen, von Triumphmarsch und Kriegsgeschrei, kurzum, die Macht des Faktisch-Visuellen gegenüber dem Musikalisch-Spirituellen, das sowohl in der melodischen Erfindung als auch in der frei strömenden „warmen“ Harmonik in Aida so reich vorhanden ist, ledig unterschätzt.

Die Dramaturgie der Mehrschichtigkeit…
Der seit 1863 regierende ehrgeizige ägyptische Vizekönig Ismail Pascha (1830- 1895) wollte dem rückständigen Ägypten in kürzester Zeit europäische Verhältnisse bescheren. Er ließ Eisenbahnlinien bauen, führte die öffentliche Straßenbeleuchtung ein, installierte Telegraphennetze, führte politische und soziale Reformen durch, ermutigte den französischen Diplomaten Ferdinand de Lesseps (1805-1894) zum Bau des Suezkanals und errichtete 1869 das erste Opernhaus auf afrikanischem Boden: Die Oper in Kairo. Deren erster Direktor wurde sein Vertrauter und Gründer der ersten ägyptischen Eisenbahn Paul Draneth Bey (1821-1895), der sich im Juli 1869 im Auftrag des Vizekönigs an Verdi wandte, mit der Bitte, für die feierliche Eröffnung vom Suezkanal und dem Opernhaus eine Hymne zu komponieren. Verdi lehnte ab, da er keine „Gelegenheitsstücke“ komponieren wollte! Zur Eröffnung der Kairoer Oper am 6. November 1869 wurde sein Rigoletto (1851) gegeben. Der Suezkanal wurde elf Tage später seiner Bestimmung übergeben: Eine Flotte von Schiffen, angeführt von der „Aigle“ mit der Kaiserin Maria Eugénie von Frankreich (1826-1920) an Bord, passierte am 17. November zum ersten die neue Wasserstraße. Im Mai schickt Camille Du Locle (1832-1903), ein mit Verdi befreundeter Librettist, Regisseur und Opernmanager, ein 23 Seiten langes Opernszenarium mit dem Titel Aida, das der berühmte Ägyptologe und Archäologe Mariette nach altägyptischen Motiven verfasst hatte, an Verdi: Der Vizekönig habe den Wunsch geäußert, erklärte Du Locle , das Verdi den Stoff für Kairo vertonen möchte. Über den Urheber des Szenariums lässt Du Locle den Komponisten im unklaren. Nach einigem Zögern und nachdem man seine Honorarforderungen von 150 000 Goldfrancs – allein für das Bereitstellen der Partitur – akzeptiert hatte, sagt Verdi zu. An der endgültigen Fassung des Aida-Librettos waren insgesamt sieben Personen beteiligt: 1. Der ägyptische Vizekönig, der Mariette die „Idee“ zum Aida-Stoff lieferte. 2. Der Ägyptologe Mariette, Chefarchäologe in den Diensten des Vizekönigs und Verfasser des ersten Handlungsentwurfs zu Aida in französischer Sprache, der 1870 in Alexandria in einer Auflage von zehn Stück gedruckt wurde. 3. Der in Paris sitzende „Vermittler“ Du Locle, der Verdi im Mai 1870 den Entwurf Mariettes übergibt. Ende Juni 1870 entwirft Du Locle in Verdis Villa in Sant’ Agata unter Verdis Aufsicht ein erstes Szenarium der Oper in französischer Sprache. 4. und 5. Vor dem Eintreffen Du Locles in Sant‘Agata bereiten Verdi und seine Frau Giuseppina Strepponi (1815-1897) eigenhändig eine italienische Übersetzung des Entwurfs von Mariette vor, auf sieben Blättern beidseitig beschriebenem Briefpapier (1. und 2. Akt) in der Handschrift Verdis, 3. und 4. Akt in der Handschrift Giuseppinas). 6. Auf der Grundlage des Szenariums von Du Locle und unter Anleitung Verdis, der ständig Veränderungswünsche äußert, erstellt Antonio Ghislanzoni (1824-1893) in den Sommermonaten 1870 die eigentliche Versifikation des Aida-Librettos. 7. Im Jahr 1904 behauptet Mariettes Bruder Auguste Édouard Mariette (1821-1881), dass die Idee einer Oper, die im alten Ägypten spielt, von ihm stamme und sein Bruder sie einfach gestohlen habe.
Am 29. Juli 1870 unterschreibt Verdi den Kontrakt für das Kairoer Opernhaus-Projekt. Als Uraufführungstermin wird zunächst Januar 1871 festgesetzt. Am 2. September fällt Sedan im Deutsch-Französischen Krieg. Die deutschen Truppen marschieren in Frankreich ein. Ende November teilt Du Locle dem Komponisten mit, dass die Arbeiten an den Kostümen und Bühnenbildern von Aida wegen der Belagerung von Paris eingestellt werden mussten. Der Uraufführungstermin wird auf den Winter 1871/72 verschoben. Am 20. September um 12 Uhr mittags übergibt Verdi eine Handschriftliche Kopie der fertiggestellten Aida-Partitur an Draneth. Das Original behält er für sich, ebenso sämtliche außerägyptischen Rechte an der Oper.

Am Heiligabend 1871 leitet Giovanni Bottesini (1821-1889) die Uraufführung von Aida im Opernhaus zu Kairo. Die in Paris gefertigten Bühnenbilder stammen aus den bekannten Werkstätten von Despléchin, Lavastre, Rubé und Chaperon, nach historisierten Entwürfen von Mariette. Er entwirft auch die Kostüme! Zwei berühmte Kritiker aus Europa, Filippo Filippi (1830-1887) und Ernest Reyer (1823-1909), sind anwesend und äußern sich wohlwollend. In der ersten Saison folgen in Kairo fünfzehn weitere Vorstellungen und bis 1949: 246 Vorstellungen!
Am 8. Februar 1872 findet an der Mailänder Scala die europäische Erstaufführung von Aida statt, unter der Leitung von Franco Faccio (1840-1891). Teresa Stolz (1834-1902) singt die Titelrolle, Maria Waldmann (1845-1920) die Amneris, Giuseppe Fancelli (1833-1887) den Radames. Der Erfolg ist überwältigend! Für Verdi gibt 32 Vorhänge! Im selben Jahr folgen Erstaufführungen in Parma und Padua. Im folgenden Jahr wird Aida in Neapel, Ancona, Buenos Aires, Triest, New York und Philadelphia gezeigt. Von 1874 bis 1881 wird die Oper an weiteren 135 Opernhäusern zum ersten Mal aufgeführt. Am 2. März 1912 wird die Oper bei den Pyramiden von Gizeh, unter freiem Himmel, gezeigt. 1972 fällt die Kairoer Oper einem Brand zum Opfer. 1987 wird Aida erstmals am „Originalschauplatzt“, vor dem Tempel in Luxor, aufgeführt.
Zur Aufführung in der Opéra National de Paris / Salle Bastille / Paris am 07. Oktober 2025:
Aida zwischen Bunkern und Geistern…
Zwischen einem monumentalen Bunker und einer geisterhaften Vision verwandelt die iranische Video-Künstlerin SHIRIN NESHAT ihre erste Opern-Inszenierung von AIDA, die 2017 bei den SALZBURGER FESTSPIELEN uraufgeführt wurde und dann in einer Koproduktion mit dem TEATRE DEL LICEU wiederaufgenommen wurde, sie transformiert die Bühne der OPERA NATIONAL DE PARIS / SALLE BASTILLE in ein ebenso intimes wie spektakuläres Fresko. Unterstützt von dem italienischen Dirigenten MICHELE MARIOTTIS mit seiner äußerst nervösen musikalischen Leitung sorgt eine Besetzung, dominiert von dem polnischen Tenor PIOTR BECZAŁA, die spanische Sopranistin SAIOA HERNÁNDEZ – die an diesem Abend von der polnisch-amerikanischen Sopranistin EWA PŁONKA ersetzt wurde – und die französisch-schweizerische Mezzo-Sopranistin EVE-MAUD HUBEAUX, an diesem Abend für eine solide und ausdrucksstarke Interpretation von VERDIS Drama…
Diese Inszenierung der iranischen-amerikanischen Fotografien und Videokünstlerin, die In Zusammenarbeit mit der deutschen Dramaturgin Yvonne Gebauer konzipiert wurde, besticht durch ihre Kohärenz und gelungenen Ästhetik. Im Zentrum der Bühne steht ein schwenkbares und drehbares kolossales Bühnenbild des deutschen Bühnenbildners Christian Schmidt, eine Art Hybrid zwischen Bunker und riesiger Styroporbox, die sich in zwei Hälften öffnen lässt.
Seine Oberfläche dient regelmäßig als Leinwand für Bild- und Videoprojektionen, die die Handlung mit Unterschiedlichem widerspiegeln. Dieser geschlossene Raum verwandelt sich abwechselnd in einen ägyptischen Hof, einen Tempel des Ptah oder im letzten in ein Grab. Um ihn herum bewegen sich unter der düsteren und sogar sehr dunklen Beleuchtung der britischen Lichtbildnerin Felice Ross die Interpreten in einer von dem deutschen Choreografen Dustin Klein gekonnt orchestrierten Bewegungsphasen, von den geisterhaften Silhouetten der Nonnen bis zum letzten, traurigen und makabren Tanz der beiden Liebenden.
Zu diesem visuellen Universum kommen die eindrucksvollen Kostüme der holländischen Kostümbildnerin Tatyana van Walsum hinzu, in denen dunkle Farbtöne dominieren, die durch einige symbolische Akzente aufgelockert werden: Das Weiß des Königs, das rote Kleid der Prinzessin oder die karminroten Schals der Richter, die wie auch zahlreiche Geheimnisse Schleier anhäufen.
Auch wenn der frische Wind fehlt, der eine Inszenierung zu einem wahrhaft mitreißenden Erlebnis macht, wird Verdis Werk dennoch respektiert und manche Passagen strahlen wahre dramatische Intensität aus, seien es die Leichen, die Amonasro seiner Tochter zeigt, um sie zum Verrat an Radames zu drängen oder auch die monumentale Projektion der Priester während der Gerichtsszene. In diesem szenografischen Rahmen konnten sich die Sänger und die musikalische Leitung orientieren!
Der Abend beginnt mit der prächtigen Stimme des rumänischen Bass Alexander Köpeczi in der Rolle des Hohenpriesters Ramfis: Ein schweres, rundes, fesselndes Timbre und ein Gesang mit einem derartigen Phlegma, die zu dieser zweideutigen Figur, dem Träger religiöser Macht, passt. Ihm gegenüber, in der ersten Szene, bricht die Begeisterung eines Radames in großartiger Form aus seiner „Celeste Aida“ hervor. Neben einer durchweg präzisen Darbietung strahlt der polnische Tenor Piotr Beczałas mit seiner Stimme sofort großen Elan aus. Brillant und volltönend bis in die höchsten Töne, ist sie mit subtilen Nuancen geschmückt, um die Stimmungen der Figur zu vermitteln, von ihrem jugendlichen Ehrgeiz bis zu ihrer endgültigen Gelassenheit, einschließlich des Unglaubens, als er weiß, dass er von Aida verraten wurde.
Von den beiden Konkurrentinnen betritt Amneris als Erste die Bühne. Die französisch-schweizerische Mezzo-Sopranistin Eve-Maud Hubeaux zeigt eine engagierte, wenn auch nicht immer ausdrucksstarke Darbietung, deren Großzügigkeit sich jedoch schnell durchsetzt. Ihre Stimme ist zunächst etwas steif, es fehlt ihr an Biss im Bass und den unteren Mitten und sie gibt die hohen Töne mit unpräziser Projektion und Stabilität wieder. Nach und nach erwärmt sich das Instrument und gewinnt eine gewisse Flexibilität, bis die Künstlerin im vierten Akt mit unermüdlicher Ausdauer eine absolut glaubwürdige Konfrontationsszene liefert. Die Stimme schafft es jedoch nie, sich von einer Ungenauigkeit zu befreien, insbesondere im Bereich der hohen Töne, was die Wünsche der Sängerin sichtlich einschränkt.
Gegenüber spielt und singt die polnisch-amerikanische Sopranistin Ewa Płonka eine monolithische Aida. Farbenfrohes Timbre, eine Stimme wie aus Stein gemeisselt, wirkt ihr Gesang etwas rustikal und in ihren beiden grossen Arien fehlt es ihr an Nuancen und dramatischer Prägung, was auf ein begrenztes Legato zurückzuführen ist, das sie jedoch modulieren kann, wenn die Figur zärtlich oder weicher wird. Die Interpretin, die zweifellos zu sehr auf die Gesangstechnik konzentriert ist, entspannt nur wirklich während der Konfrontation mit ihrem Vater Amonasro und in der Schlussszene, in der die Farben der befreiten Stimme schimmernd und weich werden.

An ihrer Seite interpretiert der russische Bariton Roman Burdenko einen Amonasro, dessen körperlicher Einsatz die Haltung eines Kriegsgefangenen und Hauptgegners des ägyptischen Regimes sehr glaubwürdig macht. Die Stimme mit ihrem heiseren und abgehackten Akzent passt perfekt zum militärischen Ethos und dem berechnenden Temperament der Figur und auch zu ihrer latenten Gewalttätigkeit. Der polnische Bass Krzyszttof Bączyk hingegen bietet einen Il Re von Ägypten mit feiner Haltung, straffem Vibratello und grauem Timbre, alles Eigenschaften, die ihn zu einer zugleich strengen, ängstlichen und manipulierbaren Figur machen, insbesondere angesichts der unerbittlichen Haltung seines Hohenpriesters. Der zurückhaltendere neuseeländische Tenor Manase Latu überzeugt in der Rolle des Messaggero und bietet eine klare und gut verbundene Stimme, etwas abgestumpft, als sei sie von den Emotion der an den Hof übermittelten Botschaft durchdrungen. Die russische Sopranistin Margarita Polonskaya verkörpert eine Sacerdotessa mit einer fleischigen Stimme und einem strahlenden Timbre, die sich mit dem Frauenchor vermischt und einen Moment bewohnter Poesie bietet.
Mit ihr und den Göttern, dann in den Triumphszenen, passt der von der chinesischen Chorleiterin Ching-Lien Wu einstudierte Choeurs de l’Opéra National de Paris mühelos die Dynamik seines gemeinsamen Gesangs an, rund und perkussiv, oszilliert zwischen den Klaviernuancen religiöser Meditation und den lyrischen Schreien fanatischer Krieger.
Die musikalische Leitung schließlich erweist sich als sehr anregend: Weit entfernt von der Grandiosität, die oft mit dieser Art von Oper verbunden wird und ohne auf die spektakulären Effekte zu verzichten, an denen es ihm nicht mangelt, entscheidet sich der italienische Dirigent Michele Mariotti dafür, der Dringlichkeit des intimen Dramas, der Dreiecksbeziehung zwischen politischen Forderungen und unterdrückten Wünschen, so nahe wie möglich zu kommen. Was dabei zum Vorschein kommt, ist eine besondere Sorgfalt für den Text und die Dialoge, ein Aufbrechen der üblichen Interpretation – auf die Gefahr hin, ein etwas überhastetes „O Terra addio“ zu bereuen -, aber auch eine theatralische Kraft und ein Einsatz von Nuancen, die unter anderen Umständen unbemerkt blieben.
Am Ende dieser mit Spannung erwarteten Neuinszenierung täuschte sich das Publikum an der Opéra National de Paris / Salle Bastille nicht: Der anhaltende Applaus würdigte diesen intensiven Abend, der vor allem von der Qualität der Besetzung getragen wurde. Das Trio Płonka – Beczała – Hubeaux erntete den größten Beifall und bestätigte damit, dass diese Wiederbelebung von Aida verdankt sowohl dem Bühnenkonzept als auch der dramatischen Kraft seiner Darsteller absolut alles.