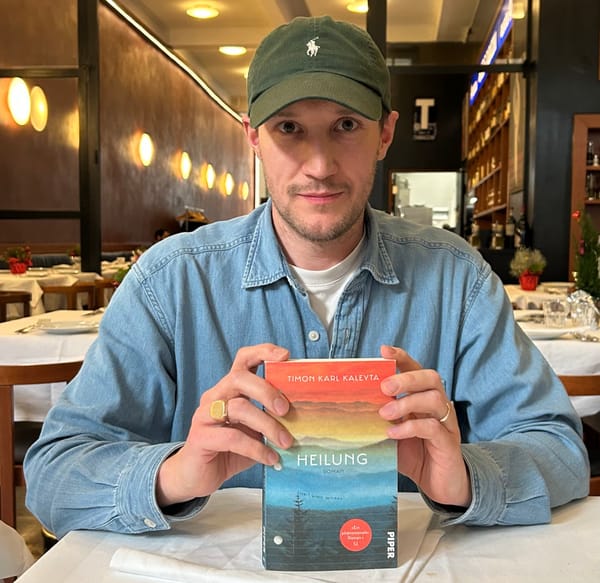Münster, im Kleinen Haus des Theaters Münster, ENDSIEG - Elfriede Jelinek IOCO

Endsieg gegen das Theater
Das Theater Münster scheitert mit Elfriede Jelineks „Endsieg“
Bei den Textflächen, die von der Literaturnobelpreis-Trägerin Elfriede Jelinek veröffentlicht werden, ist immer vor allem spannend, was für ein Theaterstück die Regie daraus macht. Im Kleinen Haus des Theaters Münster hat der junge Wilke Weermann diese Aufgabe samt Bühne und Kostüme für Jelineks „Endsieg“ aus dem Jahr 2024 auf sich genommen. „Endsieg“, vier Tage nach Donald Trumps zweitem Wahlsieg veröffentlicht, füllen Jelineks Beobachtungen und Assoziationen zur finalen US-amerikanischen Wahlkampfphase.

Die Bühne beleuchtet anfangs auf der rechten Seite eine zeitlos moderne Küche mit Tisch, Stühlen und einem großen Kühlschrank. Auf einem mittelgroßen Bildschirm an der Wand läuft gerade die Apollo-Mondlandung von 1969. Als Stimme aus dem Off verliest Katharina Brenner den Anfang des „Endsieg“-Textes. Dann ertönt das laute Geräusch eines startenden Fluggeräts, und jähes Scheinwerferlicht fällt auf der linken Bühnenseite auf eine offenbar gerade gelandete, metallisch glänzende Raumkapsel auf Stelzen. Ihr entsteigen drei Personen in amerikanischen Fantasiekostümen (Daryna Mavlenko, Artur Spannagel, Luise Ziegler). Sie tragen blaue Cowboy-Hüte, blaue Uniformjacken mit Epauletten und der Aufschrift „Space Force“, schwarze Hosen mit roten Offiziers-Streifen an der Seite und weiße Stiefel mit Sporen. Als Bewaffnung tragen sie Pistolen am Gürtel. Wie der Regisseur im Programmheft erläutert, spielt das Stück in einem geheimen Filmstudio, wo „die Fake-Marslandung vorbereitet wird, ultimatives Wunschkind aus der Ehe von Kapital und Politik“.
Das könnte spannend werden, wenn es denn Theater würde. Aber bereits diese früheste Stelle zeigt die durchgängige Schwäche der Inszenierung. Der an sich wirklich gute Witz der absurden „Raumfahrer“-Kostümierung, die zeigen kann, welche Dummheiten dem fernsehenden, alternativen Fakten geneigten Publikum zugemutet werden können, setzt die Lektüre des Programmhefts voraus. Ohne das bleibt der Witz Idee, wird nicht ausgespielt und bleibt für die Handlung so unbedeutend wie die Raumkapsel, die bis zum Ende unbenutzt und bedeutungsleer herumsteht.
Nachdem die drei Raumfahrer eine US-amerikanische Flagge auf dem rötlich-braunen, am Rand felsigen Boden ausgebreitet haben, beginnen die Drei zwischen Raumschiff und Küche eine Unterhaltung im Alltagston, von der nicht klar ist, ob sie sich wirklich so unterhalten oder ob der Text zu ihrer Raumfahrer-Rolle gehört. Es geht darin um den wiedergewählten Trump als auferstandener Messias oder als König, aber auch als einer, der kleiner ist als sein „Schatten“, der ihn ersetzen wird. Auch das Wahlvolk wird abgewatscht, das endlich, nach langem Streben nach oben, nun von oben nach unten drücken darf - alles recht pauschal und wenig originell.
Gegen den Alltagston sträubt sich allerdings der Text, der eher assoziativ dahinmäandert und keine für eine Unterhaltung passende diskursive Struktur hat. Die Regie hilft sich aus dieser Verlegenheit, indem sie Daryna Mavlenko, Luise Ziegler und Artur Spannagel Text-Teile von möglichst einer solchen Länge zuteilt, dass sich an deren Ende etwas Fassbares, eine klare Aussage, ein erkennbares Bild oder ein Kalauer findet. Dieses Unterhaltungs-Fake ebnet ansonsten alle Aussagen bis zur Beliebigkeit ein, ein Zitat aus der 2000 Jahre alten „Ilias“ Homers, Anklänge an Paul Celans „Todesfuge“ von 1948 und eine Fernsehnachricht von 2025 plätschern gleichwertig so dahin. Das alles ist nicht klar gedacht und fällt nur kaum auf, weil es mit den beliebigen Handlungen auf der Bühne selber nichts zu tun hat.

Szenisch geschieht nämlich zu alldem zwischen Raumschiff und Küche so gut wie nichts. Der dramatische Höhepunkt dieses „Endsieg“ besteht darin, dass Luise Ziegler von der Bühne aus mit ihrer Pistole einen Mann im Zuschauerraum (Franz-Helmut Richter) erschießt. Aber das stellt nicht etwa das Attentat auf Trump dar, auf das sich die Unterhaltung an anderer Stelle deutlich bezogen hat. Vielmehr überlässt die Regie dem Publikum die Deutung, warum das Opfer überhaupt erst erschossen, dann auf die Bühne und schließlich in einer Stars-And-Stripes-Flagge in die Kulissen getragen wird.
Das gesamte Zusammenwirken von Text, Bühnenhandlung und Bühne, selbst das Sprechen über microport, das noch von Musik und Sounddesign von Constantin John überlagert wird, ist nicht auf irgendeine Art von Verständlichkeit angelegt. Text rauscht knappe eineinhalb Stunden ohne Pause vorbei, bis sich immer einmal wieder etwas sowieso Vertrautes oder ein mauer Kalauer findet, bei dem das Publikum sich wieder einklinken kann. Alles zielt auf eine kuriose Einfühligkeit, bei der das Theater von nahezu allen seinen guten Geistern verlassen ist und als kritische Institution abdankt.
Den schwachen Beifall des Premierenpublikums verdienten sich die aufopferungsvoll agierenden Daryna Mavlenko, die noch schön zur Gitarre sang, Artur Spannagel und Luise Ziegler.
Die nächsten Termine: 10., 17., und 25.10., 1., 7. und 16.November.