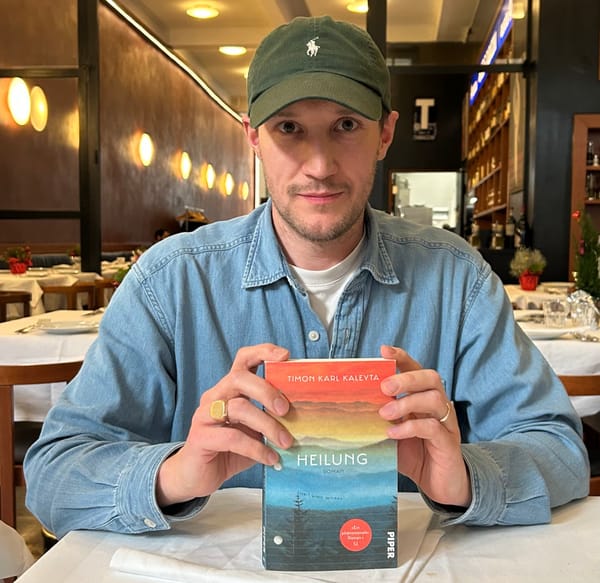Frankfurt a.M., Oper Frankfurt, ALCINA - Georg Friedrich Händel, IOCO

Von Ljerka Oreskovic Herrmann
Die 1735 in recht kurzer Zeit von Georg Friedrich Händel komponierte Oper Alcina sollte nicht nur ihrem Schöpfer, sondern auch der italienischen Oper in London (endlich) den ersehnten dauerhaften Erfolg bringen. Händels zweites Werk für das von John Rich geleitete Theatre Royal in Covent Garden kam nicht nur zur rechten Zeit, sondern es gelang ihm mit Alcina ein regelrechter Triumph, in dem Gesang, Musik und Ballett für ein allumfassendes Theaterereignis sorgten. Rich hatte die Tänzerin Marie Sallé (und ihre Compagnie) noch unter Vertrag, die mit ihren unkonventionellen Kostümen und ihrem Tanz bleibende Spuren in der Theatergeschichte Londons – und insbesondere in Paris – hinterließ. Händel war übrigens nicht der einzige Komponist, der sich mit der damals sehr beliebten Thematik beschäftigte, unter anderem hat auch Antonio Vivaldi, dessen Werke zur Zeit eine Renaissance erfahren, den Orlando furioso in einer gleichnamigen Oper vertont. Der rasende Roland – das Versepos von Ludovico Ariosto wurde erstmals 1516 gedruckt – hieß er dann in der gut einhundert Jahre später erfolgten deutschen Übersetzung. Darin geht es in mehreren Haupt- und Nebensträngen um menschliche Intrigen und äußerst verkürzt auch um den Verlust des Verstandes im Liebesrausch, insbesondere im Teil L’isola di Alcina, auf dem Händels Werk basiert, hierbei jedoch das Übernatürliche im Vordergrund steht und zu allerlei Verirrungen und Verwicklungen führt, was sich im Barock ungemeiner Beliebtheit erfreute.
Trailer zu Alcina Oper Frankfurt YouTube
Kaspar Glaner, der für Bühnenbild und Kostüme verantwortlich zeichnet, kreiert ein neobarockes – schwarz dominiertes – Ambiente der Zauberin Alcina mit Klappen und lichtdurchlässigen Öffnungen gestaltet, die interessante Auftritte ermöglichen, während seine Kostüme dieses kontrastierend eine farbenfrohe und elegant anmutende Angelegenheit sind. Den Weg der Zauberin schmücken und beglaubigen seine Kostüme: morgens ein weißes Hemd, dann ein paillettenbestücktes Cocktailkleid (Art Deco-Style) und am Ende ein eleganter pinkfarbener Seidenanzug. Nur für einen alles entscheidenden Moment wird der Kostümreigen ausgebremst, als Alcina, dieses Mal im schwarz-barocken der übergroßen Puppe im Hintergrund entliehenen Kleid, erkennen muss, dass ihre magischen Kräfte nicht mehr wirken, die Geister ihren Befehlen nicht mehr folgen. Man könnte es – moderner gesprochen – auch als Befreiungsschlag werten, zwar von allen verlassen und damit – im Gegensatz zu den anderen – ein Single, ist sie doch in dieser Endlosschleife gefangen gewesen, wenn sie ihre Liebhaber überdrüssig geworden in Steine, Blumen oder Tiere verwandelte. Johannes Erath, der Regisseur, zeichnet das Bild einer mit allerlei Zauberkräften versehenen, jedoch verletzlichen Frau, die am Ende zwar verliebt aber einsam in ihrem ruinierten Zuhause zurückbleibt. Ihre Magie – in doppelter Weise – ist dahin, wohingegen die Schwester Morgana ihr Liebesleben nach anfänglichen Turbulenzen wieder in Ordnung gebracht hat und auch das andere Paar, Bradamante und Ruggiero, ebenso zueinander findet.
Vielleicht nicht im Händelschen Sinne, als Schlussbild aber sehr wirkungsvoll: Alcina, von Monika Buczkowska-Ward wandlungs- und stimmsicher gegeben, sitzt im Halbprofil alleine auf ihrer gottverlassenen Insel. Die Sopranistin weiß um ihre Figur, ihren inneren und äußeren Absturz und verleiht ihr nichtdestotrotzt eine Würde; sie ist nicht (mehr) gefährlich, kein kaltschnäuziges und gnadenloses Biest, sondern stattdessen eine Frau, die um ihretwillen geliebt werden möchte, gleichwohl sie selbst für das auch von ihr angerichtete Trümmerfeld der eigenen Gefühle Verantwortung trägt. Diese Balance und Entwicklungslinie gelingt Buczkowska-Ward auch stimmlich in beeindruckender und hinreißender Ausdrucksstärke.

Die Partie der Bradamante – ein Mezzo bis Alt – schrieb Händel der Altistin Maria Caterina Negri, die auch in Vivaldis Werken auftrat, auf den Leib. Sie ist der Gegenentwurf zur Zauberin und löst mir ihrer Ankunft auf deren Insel die Lawine der Ent- und Verwicklungen aus. Katharina Magiera erweist sich als Idealbesetzung für diese Figur, ihr gelingt der nicht einfache Spagat zwischen maskulinem Auftreten – schwarzer Smokinganzug und glatt gestrichener Bob ebenfalls in Anlehnung an das Art Deco – und femininen Anliegen: die Rückeroberung ihres Bräutigams Ruggiero. Auch gesanglich muss sie – im wahrsten Sinne – alle Register ziehen, ihre Partie liegt nicht selten sehr tief, was Magiera bravourös meistert. Zugleich muss Bradamante – sie gibt sich als ihr eigener Bruder Ricciardo aus – sich der sehr eindeutigen Annährungsversuche von Morgana, die sich blitzartig in sie verliebt und ihren Geliebten Oronte damit in die Verzweiflung treibt, erwehren. Und es kommt für sie noch schlimmer, denn Ruggiero erkennt sie nicht; er glaubt tatsächlich Ricciardo vor sich zu haben, der seinerseits nun Alcina zu begehren scheint und damit Ruggieros gewohntes Liebesleben, irgendwie unnötig, jedoch erheblich durcheinander wirbelt. Denn er ist ein liebenswürdiger, aber etwas verloren wirkender junger Mann, der es sich in Alcinas Bett durchaus bequem eingerichtet hat und bisher keine Konkurrenz fürchten musste. Elmar Hausers samtener Countertenor befördert charmant dieses Bild eines etwas unbeholfenen jugendlichen Liebhabers, der später allerdings recht unsanft aus dem Bett geworfen wird und Entscheidungen treffen muss. Das Schlimme ist eigentlich, nicht zu wissen, wem er glauben oder vertrauen soll: Ist Ricciardo wirklich Bradamante? Ist Alcina in diesen, der vorgibt Bradamante zu sein, verliebt? Am allerwenigsten scheint er seinen Gefühlen zu trauen.
Melisso, Bradamentes treu ergebener Begleiter, stets dezent und doch präsent gegeben von dem Bariton Erik van Heyningen, wird nicht zuletzt auch dafür sorgen, dass Ruggiero aus seiner misslichen Lage einen Ausweg und den Weg zu Bradamante findet.
Shelén Hughes schöner und vollmundiger Sopran verleiht der quirligen, beherzten und weitaus lebenslustigeren Morgana – im Gegensatz zu ihrer „zaubernden“ Schwester Alcina – den nötigen Kontrast; sie liebt ihren Oronte bis eben Bradamante alias Ricciardo auftaucht und bei ihr neue Sehnsüchte weckt.

Oronte, zunächst gut gelaunt, entpuppt sich immer mehr als trauriger Clown – übergroß wird der Schminkvorgang auf die Leinwand projiziert –, für den die Ereignisse unaufhaltsam in die falsche Richtung weisen. Michael Porters Tenor vermag die verschiedenen Gefühlslagen gekonnt wiederzugeben; er ist gewissermaßen das männliche Spiegelbild von Alcina, wohl auch weil er als einziger ein Kostüm des 18. Jahrhunderts trägt, allerdings mit dem Unterschied, dass für ihn die ganze Sache positiv endet, obwohl er bereitwillig die diversen Intrigen und Anschuldigungen in Umlauf bringt und die erhofften Reaktionen verfolgt. Er bezichtigt Bradamante des Anbändelns mit Alcina, die wiederum Ruggiero zu verwandeln beabsichtigt – der Zwist ist gesät. Alcina und Ruggiero vertrauen einander nicht mehr und der Untergang der Zauberinsel ist absehbar.
Einzig Oberto hat ein „echtes“ Hühnchen mit Alcina zu rupfen. Diese Rolle hatte Händel eingefügt, sie ist im Epos nicht enthalten, weil seine Begeisterung für die Fähigkeiten des jungen William Savage, der die Uraufführungspartie gesungen hatte, auch in Alcina zur Geltung kommen sollten. Er sucht seinen Vater, den Alcina in einen Löwen verwandelt hat, und seine Wut schleudert er ihr entgegen. Gesungen wird die (für einen Knabensopran geschriebene) Figur von der Sopranistin Clara Kim mit großer Intensität und Wucht.
Die barocke Bühnenmaschinerie, so Regisseur Erath, veranschaulichen nicht nur die Klappen, sondern auch der gegen Ende auseinandergezerrte Bühnenboden, was nicht nur eine Erfindung des barocken Theaters ist, in diesem Fall steht er sinnbildlich für die Tatsache, dass alle ja auch den Boden unter den Füßen zu verlieren scheinen – was tatsächlich nur für Alcina zutrifft. Der Verlust ihrer magischen Fähigkeiten ist irreparabel. Das Ganze zauberhafte Geschehen ist für Erath und Glaner heutzutage weniger Spiel (und Belustigung im barocken Sinne) als ein einziger Zirkus, in dem die Akteure wahlweise Handelnde oder auch Beobachter sind und auf der überlangen Couch dafür Platz nehmen. Frei sind sie in ihren Ausführungen nicht, Illusion ist alles.

Das barocke – von Händel und seinen Mitstreitern inszenierte Spektakel – wird hier zu einer Zirkusveranstaltung; das Ballett ersetzen „Zirkusmänner“, allesamt Mitarbeiter der Statisterie der Oper Frankfurt. Dass Oronte nicht der einzige Zirkusspieler bleibt – in der Kettensägeszene, in der er sich Bradamente zu entledigen sucht, sorgt sein Auftritt für einen Lacher im Publikum – verdankt sich ebenso dem Wirken der Statisten der Oper Frankfurt und verdienen genannt zu werden: Maximilian Kutzner, Gianfranco Gariano, Cosmo Hahn, Daniel Hartlaub, Axel Pastor, Wolfgang Schreiber, Lukas Schaan, Lukas Weiß, Leonard Cubr und Valentin Stier. Ihre ständige Präsenz, ihre stummen Verrenkungen und durchaus handfesten Aktionen – sie gehen nicht gerade zimperlich mit dem schwankenden Ruggiero um – dient aber dem Interpretationsansatz.
Bibi Abel sorgt für die teils sehr bildkräftigen Videoprojektionen, der erwähnte geknickte Clown – ein Bild, was sich hartnäckig erhalten und eingeprägt hat – könnte als sachter Hinweis verstanden werden, dass nicht nur im Zirkus traurige Gestalten vorkommen. Joachim Klein, für das Licht zuständig, setzt dieses auf bewährte und gekonnte Weise ein, die Klappen und Aussparungen als Stimmungsgeber nutzend. „The show must go on“ – heißt es doch so schön. Auch wenn Alcina dafür zurückgelassen wird, eine neue Rolle wird sie schon finden oder vielmehr: der ganze Zirkus beginnt immer wieder von vorn.
Die Frankfurter Erstaufführung überzeugt besonders stark durch das Gesangsensemble und Orchester unter der Leitung von Julia Jones. Ihr konzentriertes Dirigat rückt die Solisten auf der Bühne und im erhöhten Graben und damit die strahlende und verführerische Musik Händels, die entscheidend die Handlung bestimmt und vorantreibt, in den „zauberhaften“ Mittelpunkt. Stellvertretend für die gesamte Leistung des Orchesters seien besonders die Lautenspieler Sam Chapman und Silas Bischoff wie auch die Cembalisten Luca Quintavalle und Felice Venanzoni erwähnt. Johannes Kofler hat ein beeindruckendes Cello-Solo wie auch sein Kollege Ingo de Haas an der Violine. Nicht zuletzt sollten auch Karen und Ulrich Hübner an den Waldhörnern gewürdigt werden.
Der große und langanhaltende Applaus galt vor allem den Mitwirkenden – auf der Bühne und im Graben – einschließlich der anerkennenden Leistung der Bühnenarbeiter, die mit der für den Ablauf wichtigen und reibungslosen Verschiebung der Wände befasst waren.