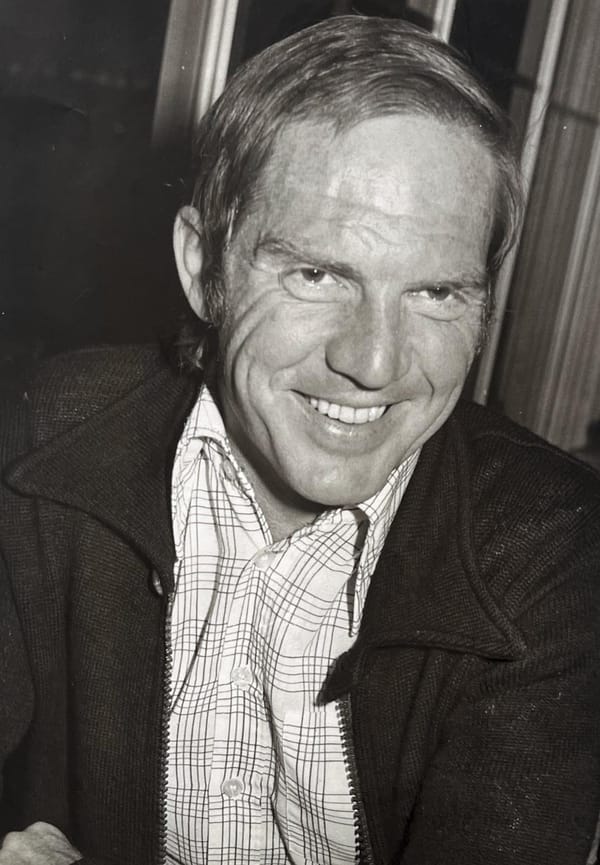Berlin, Konzerthaus, F. MENDELSSOHN BARTHOLDY, R. WAGNER, Catherine Foster, Iván Fischer, IOCO
Ein Konzert mit geistlicher Tiefe und dramatischer Wucht: Iván Fischer und das Konzerthausorchester Berlin verbinden Mendelssohns „Reformations-Sinfonie“ mit Wagners „Götterdämmerung“. Catherine Foster glänzt als Brünnhilde mit strahlender Stimme und emotionaler Intensität.

von Ingrid Freiberg
Ein Konzertprogramm mit großer Sprengkraft
Felix Mendelssohn Bartholdy
Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 107 („Reformations-Sinfonie“)
Dass die d-Moll-Sinfonie als 5. gezählt wird, liegt an ihrer posthumen Veröffentlichung; in der Chronologie steht sie an zweiter Stelle, sie entstand „zur Feier der Kirchen-Revolution“ zum 300. Jubiläum des Augsburger Bekenntnisses von 1530. Mendelssohn erlebte einige Widrigkeiten mit dieser Sinfonie, die er selbst als nicht vollkommen empfand: Politische Wirren verhinderten die Jubiläumsaufführung, ein Pariser Aufführungsvorhaben scheiterte und der Auftritt bei der Bewerbung für die Leitung der Berliner Singakademie erwies sich als erfolglos. Bis heute steht das Werk im Schatten der Sinfonien 3 und 4, möglicherweise auch deshalb, weil gegen die religiöse Orientierung Vorbehalte bestehen.
Die 5. Sinfonie ist ein eher traditionell angelegtes 4-sätziges Werk mit langsamer Einleitung in rein instrumentaler Ausprägung, dessen geistliche Bezüge sich auf wenige Merkmale reduzieren lassen, auf eine insgesamt archaisch klingende Harmonik und auf drei Elemente aus der Liturgie. So erklingt in der Einleitung der Beginn des „gregorianischen Magnificat“ und bald darauf das „Dresdner Amen“ (das Richard Wagner später im Parsifal melodisch und instrumentatorisch-harmonisch als „Gralsmotiv“ verwendete) und im letzten Satz schließlich Luthers Choral „Ein’ feste Burg …“. Im Kopfsatz kehren „Magnificat“ und „Amen“ als thematische Bausteine in der Exposition des auf die Einleitung folgenden Sonatensatzes wieder, dessen Durchführung kontrapunktisch gearbeitet ist. Der 2. Satz, ein „Allegro vivace“ in B-Dur, wirkt auf den unvorbereiteten Hörer wie ein farbiges weltliches Intermezzo. Das kurze „Andante“ in g-Moll hat den Charakter einer lyrischen Einleitung zum finalen „Andante con moto – Allegro maestoso“. Zunächst exponiert Mendelssohn Luthers „Choral“, dann verknüpft er Sonatensatz und Choralvariation miteinander und stellt zugleich durch Zitate aus den drei vorangegangenen Sätzen einen übergeordneten Zusammenhang her.

Wagners Hassliebe zu Mendelssohn
Wagner beneidete Mendelssohn. Gegenüber seinem Freund Hans von Wolzogen gesteht er: "Wie stümperhaft kam ich mir vor als junger Mann, nur vier Jahre jünger als Mendelssohn, der ich erst mühsam anfing, Musik zu treiben, während jener schon ein ganz fertiger Musiker war." In einem Brief schrieb er: "Verehrter Herr! Ich führe den Streich aus, den Sie so gütig waren, im Voraus einen gescheuten zu nennen, u. bitte Sie beiliegende Symphonie, die ich 18 Jahre alt schrieb, als Geschenk von mir anzunehmen; ich wüßte keine schönere Bestimmung. Vielleicht reicht sie hin, Ihnen einen Beweis meines redlichen Bestrebens und meines Fleißes zu geben, u. ich bedarf dieser günstigen Vormerkung von Ihnen, da Sie mich vielleicht verdammen würden, wenn Sie, ohne diese Basis meiner Studien zu kennen, sogleich meine neueren Kompositionen beurteilen sollten. Mit Verehrung Ihr ergebenster Richard Wagner Mus.Dir." Insgeheim hoffte Wagner, dass Mendelssohn seine Symphonie in Leipzig aufführt. Dieser reagierte jedoch nicht … Ein paar Jahre später suchte er ihn in Berlin auf, wo Mendelssohn seinen Fliegenden Holländer auf die Bühne brachte. Wagner dankte Mendelssohn in einem schmeichlerischen Brief. "Mein lieber, lieber Mendelssohn, ich bin recht glücklich, daß Sie mir gut sind. Bin ich Ihnen ein klein wenig näher gekommen, so ist es mir das Liebste von meiner ganzen Berliner Expedition." Kamen sich Wagner und Mendelssohn wirklich näher? Wohl kaum. In seiner Autobiografie "Mein Leben" liest sich das Ganze schon anders. Dass Mendelssohn auch bei diesem Treffen die Zusendung der Symphonie mit keinem Wort erwähnte, wurmte Wagner: "Nach dem Schicksal der Partitur meiner großen Symphonie, frug ich ihn nicht; wogegen auch er in keiner Weise mir verriet, daß er sich dieses sonderbaren Geschenkes erinnere. In seiner reichlichen häuslichen Umgebung machte er einen kalten Eindruck auf mich, jedoch stieß er mich weniger ab, als ich vielmehr von ihm abglitt." Blanker Neid spricht aus diesen Worten. Inhaltlich und musikalisch harmonieren Mendelssohn und Wagner allerdings hervorragend. Jedoch birgt die Kombination des gebürtigen Juden und des radikalen Antisemiten große Sprengkraft. Mendelssohn war für Wagner Zentrum seiner Hetzkampagne gegen den jüdischen Einfluss auf die Musik. Dass Mendelssohn protestantisch getauft war und Wagner die ein oder andere musikalische Idee lieferte, spielte für den Meister von Bayreuth dabei keine Rolle.
Brünnhilde erlöst mit ihrem Schlussgesang die Menschheit
Knapp 30 Minuten braucht es in der Sinfonie Nr. 5 von Felix Mendelssohn Bartholdy bis zur Erlösung. Ganz anders bei Richard Wagner: Mit über 15 Stunden Ring des Nibelungen - an vier Opernabenden - geht es ihm um die Erlösung der gesamten Menschheit, während sich Mendelssohn „nur“ auf die Erlösung des Christentums bezieht. Mendelssohn zeichnet die Entwicklung der Kirche mit all ihren Verwirrungen und Konflikten innerhalb des Katholizismus nach, musikalisch versinnbildlicht durch „Ein’ feste Burg …“. Als nicht so gefestigt zeigen sich Burg und Götter am Ende der Götterdämmerung. Die Götterburg Walhall wird von Flammen und den Fluten des Rheins verschlungen. Die Menschheit hingegen wird von Brünnhilde erlöst. Mit ihrem im wahrsten Sinne des Wortes ausufernden Schlussgesang leitet Catherine Foster die Vollendung ein, bevor auch sie im Flammen- und Flutenmeer untergeht.

Genial verbundene Orchesterzwischenspiele und ein überwältigender Schlussgesang
Für das Publikum überraschend und faszinierend zugleich erklingen Auszüge aus der Götterdämmerung: „Sonnenaufgang“, „Siegfrieds Rheinfahrt“, „Siegfrieds Tod“ und der „Trauermarsch“. Genial werden die Orchesterzwischenspiele miteinander verwoben, eine bisher nie gehörte Spannung kommt auf. (Eine Aufnahme wäre ein Geschenk für jeden Wagnerianer!) Brünnhildes zwanzigminütiger Schlussgesang ist ein stimmlicher Kraftakt, zu dem nur wenige Sopranistinnen in der Lage sind. Wagner bietet an orchestralen Klangfarben, Leitmotiven und Dramatik alles auf und lässt Brünnhilde ihre unendliche Liebe zu Siegfried sowie das Ende der Welt und der Götter besingen: „Starke Scheite schichtet mir dort am Rande des Rheins zuhauf!… Siegfried! Siegfried! Sieh! Selig grüsst dich dein Weib!“
Die innere Größe und dramatische Leichtigkeit der Stimme von Catherine Foster, klar, ruhig und raumfüllend, mit charakteristischem Timbre, lässt aufhorchen. Sie besitzt die Fähigkeit, Worte nachdenklich zu wägen und gleichzeitig einen großen Klangraum zu fluten. Zum Ende von „Brünnhildes Schlussgesang“ lässt sie ihre Stimme noch einmal aufblühen und zu voller Pracht anwachsen. Sie bewahrt ohne konditionelle Einbußen mit enorm sinnhafter Ausdruckskraft Würde, Haltung und Aufrichtigkeit. Jauchzend, mitfühlend und bewegend versteht sie es, alle in ihren Bann zu ziehen.
Unter der Musikalischen Leitung von Iván Fischer leuchtet das Konzerthausorchester Berlin auf, präsentiert sich in Höchstform und sorgt sowohl bei Mendelssohn als auch bei Wagner für magische Momente. Der spirituelle Aspekt der Sinfonie Nr. 5 wird bemerkenswert hervorgehoben. Schnell entspinnt sich ein starker Sog, Transparenz und Wohllaut treffen aufeinander. Die Bläser verströmen einen betörenden Klang, während die Streicher ihre Instrumente subtil zum Klingen bringen. Das Orchester geht kontemplativ und vieldeutig zu Werke, weihevoll ist Musik und Erschütterung spürbar. Präzise nehmen die Interpretationen ihren Lauf. Die perkussiven Passagen sind sprühend, gerade weil sie nicht übersteigert dargeboten werden. Schwelgerische Stimmungen und dramatische Umschwünge begeistern im Wechsel. Der warme Klang der Musiker wird beibehalten, untergründige Wellenbewegungen der tiefen Streicher kontrapunktieren die aufblühenden Geigen mit an- und abschwellender Dynamik. In Brünnhildes Schlussgesang orchestriert Fischer die epische Musik, die von starken Bläsersoli, betörenden Streichern, den Harfen und einer wuchtigen Tuba getragen wird. Brünnhildes Liebe wird durch die Dynamik der Musik lebendig. Fischers Dirigat führt zum Untergang, zum Weltenbrand, aber auch zur Hoffnung auf Wiederherstellung eines neuen, besseren Zeitalters. Er beweist höchste Konzentration und musikalische Präzision und bringt die volle Dramatik, deren emotionale Wucht zum Abschluss und untermalt dabei die Ahnung von der bevorstehenden Zerstörung der Götterwelt.
Tief bewegt und mit lang anhaltendem Beifall für die herausragende Aufführung erhebt sich das Publikum von seinen Plätzen.