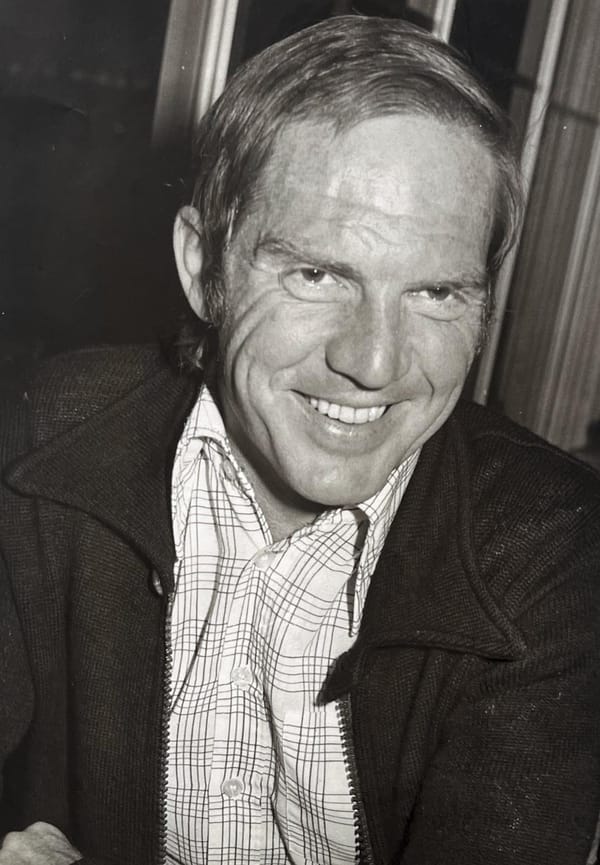Bayreuth, Bayreuther Festspiele, TRISTAN UND ISOLDE – Richard Wagner, IOCO
Andreas Schager als Tristan, Camilla Nylund als Isolde und Günther Groissböck als König Marke prägen Bayreuths „Tristan“. Thorleifur Örn Arnarssons Inszenierung setzt auf Erinnerung und Symbolik, Semyon Bychkov entfaltet mit dem Festspielorchester farbenreiche Intensität.

von Karin Hasenstein
Aus den Tiefen der Erinnerung
„Er sah mir in die Augen“
Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“, oder wie er sie selbst nannte, Handlung in drei Aufzügen, umfasst neben rund vier Stunden Musik noch eine umfangreiche Handlung, die nicht in den drei Aufzügen erzählt wird, sondern in der Rubrik „Was bisher geschah“ als Vorgeschichte zusammengefasst und als bekannt vorausgesetzt wird.
Vorgeschichte
Tristan wird als Jugendlicher von norwegischen Kaufleuten entführt und nach einem heftigen Sturm in Cornwall an Land gebracht. Mit einer Jagdgesellschaft gelangt er schließlich an den Hof von König Marke, wo er als Jäger und Musiker lebt. Als Tristans wahre Identität bekannt wird, wird er von seinem Onkel in den Ritterstand erhoben. Da König Marke ohne Frau und kinderlos ist, setzt er Tristan als seinen Alleinerben ein.
Um den Mord an seinem Vater zu sühnen, tötet Tristan Morold und schickt dessen Kopf dem irischen König. Morolds Schwert war jedoch vergiftet und Tristan wurde im Kampf damit verwundet. Isolde, die irische Prinzessin und Verlobte Morolds verfügt jedoch über Heilkräfte, denn sie war es selbst, die Morolds Schwert vergiftet hat. Tristan weiß, dass nur Isolde daher über die nötigen Kenntnisse verfügt, seine Wunde zu heilen.
Tristan fährt nach Irland und nimmt eine falsche Identität an, er gibt sich als Spielmann Tantris. Isolde pflegt Tristan gesund und entdeckt dabei, dass der Splitter in der Wunde genau in Morolds beschädigtes Schwert passt. Sie erkennt in Tantris ihren Erzfeind Tristan, der ihren Verlobten tötete, und zieht ihr eigenes Schwert. Als ihre Blicke sich begegnen, lässt sie von ihren Racheplänen ab. Sie pflegt Tristan gesund und lässt ihn unerkannt gehen.
Zurückgekehrt an Markes Hof, wird der König aufgefordert, wieder zu heiraten. Tristan drängt Marke dazu, Isolde zu heiraten und ihn als Brautwerber nach Irland zu entsenden. Marke willigt zögernd ein und Tristan überquert ein weiteres Mal das Meer, um Isolde als Braut König Marke zuzuführen.
Soweit die in der Oper nicht gezeigte Vorgeschichte von Tristan und Isoldes Kennenlernen.
Erster Aufzug
Der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnasson legt den Fokus in seiner Inszenierung auf diese Vorgeschichte und ihre Auswirkungen auf die beiden Protagonisten.
Das spiegelt sich im Bühnenbild wider, das einerseits sehr auf das Wesentliche reduziert ist, an anderen Stellen aber extrem detailverliebt ist. Der Schwerpunkt liegt auf den Szenen, in denen Tristan und Isolde von der Tagwelt in die Nachtwelt gleiten und alles um sie herum verschwimmt und bedeutungslos wird.
Tristan und Isolde ist ein Opus Metaphysicum der Liebe.
Das Erleben der Handlung wird zum empathischen Mitvollzug des Leidens der Figuren auf der Bühne. Wenn man die Bühne betrachtet, kommt einem das Zitat von Jean Paul in den Sinn: „Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.“
Es geht in dieser Inszenierung sehr zentral um die Erinnerung. Wagner nannte das Werk „Handlung in drei Aufzügen“.
In dieser Handlung kehren Tristan und Isolde in das Paradies ihrer Erinnerung zurück, und zwar die Erinnerung an die in der Handlung nicht gezeigten und nur erzählten Vorgeschichte, die aber für das Verstehen derselben von großer Bedeutung ist. In längeren Monologen der Hauptfiguren werden die Zusammenhänge hergestellt, ohne die man die Handlung nicht verstehen kann. Wir befinden uns auf Tristans Schiff, mit dem Tristan zu König Marke unterwegs ist, um ihm seine junge Braut Isolde zuzuführen. Das Dramatische daran ist, dass Tristan und Isolde da bereits ineinander verliebt sind. Örn Arnasson führt seinen statischen Ästhetizismus von schwacher Bewegung bis hin zum völligen statischen Stillstand. Dabei setzt er auf Archaik und Reduktion. Die Bildsprache ist zunächst karg, weit, etwas steif, die Figuren sind gefangen in den Relikten ihrer Vergangenheit. Örn Arnasson spannt weite Bögen, die Zeit wird spürbar bis zum hypnotischen Stillstand. Die zwischen Tristan und Isolde bestehende Liebe auf den ersten Blick in der Vorgeschichte wird nicht gezeigt. Die erzählte Handlung kreist um die Vergangenheit. Es geht darum, den magischen Augenblick zurückzugewinnen. Die gezeigte Handlung auf der Bühne ist nur traurig. Die Aura der Liebe zwischen Tristan und Isolde wird zu einer einmaligen Erscheinung ihrer Vergangenheit. Das Glück stellt sich unwillkürlich ein, man kann es nicht herstellen, der auratische Moment der ersten Begegnung kann nicht wiederholt werden. Örn Arnassons Fokus liegt auf den Figuren, die im Verlauf des Abends alle emotionalen Stadien durchlaufen. Er inszeniert das Vorspiel nicht. Der Vorhang bleibt geschlossen, das Drama liegt in der Musik selbst, die Handlung ist die Musik. Der Ort des ersten Aufzugs, Tristans Schiff, ist abstrakt und sehr dunkel. Der theatrale Apparat wird offengelegt, wir sehen im Hintergrund viele Scheinwerfer, die eine Illusion erzeugen, welche visueller Ausdruck der Handlung ist, die in der Musik ist. Er zeigt die Theaterwirklichkeit. Spezielle Natriumdampflampen, die zeitverzögert immer heller erstrahlen, erzeugen ein besonderes goldenes Licht. Das Schiff ist ein Nichtort, es bewegt sich über das Meer. In der Mitte der Bühne, des Schiffsbodens, klafft ein Loch, als wäre ein Meteorit eingeschlagen. Sinnbildlich ist hier die Liebe zwischen Tristan und Isolde eingeschlagen. Isolde sitzt lange Zeit inmitten ihres Kleides, ein übergroßes weißes Kleid, wie ein Brautkleid, das mit schwarzen Worten beschrieben ist und von ihr im Verlauf der Handlung wie getrieben immer weiter beschrieben wird. Bei den Worten handelt es sich um Zitate aus dem Libretto. Das Kleid ist für Isolde wie eine Insel, von der sie nicht herunterkann, die sie isoliert, aber auch schützt. Das Beschreiben des Kleides mit den Zitaten ist eine Reflexion der äußeren Handlung. Wenn die Personen wortlos sind, heben sie das Kleid an und lesen die Worte. Das Kleid ist Isoldes Intimraum, hier kann sie nicht verletzt werden. Sie verlässt diesen sicheren Hafen erst, als Tristan kommt! Manchmal ist die Musik dem Text voraus, der Kopf ist dem Herz hinterher. Tristan befindet sich in einem unlösbaren Konflikt zwischen seinem Ich und seiner Rolle an König Markes Hof. Er verdrängt diesen Konflikt jedoch und gerät in eine Depression. Er verlässt die Szene. Wagner stellt schwachen Männerfiguren oft sehr starke Frauen entgegen. Isolde setzt ihre Brautmaske auf. Der Gesichtsverlust bedeutet einen Identitätsverlust. Eine gewisse Verwirrung entsteht über die Tränke. Gibt es gar keinen Liebestrank, nur einen Todestrank? Brangäne hat den Todestrank gegen den Liebestrank ausgetauscht, damit die beiden sich verlieben und nicht gemeinsam in den Tod gehen. In der Todeserwartung fallen schließlich die Masken. Die Wirkung des Tranks entsteht dadurch, dass alle daran glauben. Es ist nicht die Wirkung des Trankes selbst, der hätte auch Wasser sein können. Es ist ein Placebo-Effekt. Tristan lässt die Flasche in den Trichter fallen und die unglückliche Liebe selbst ist das Gift, das zur Vernichtung führt.

Zweiter Aufzug
Im zweiten Aufzug befinden wir uns im Schiffsbauch als dem Symbol für das Unterbewusstsein. Oben ist Tag, unten ist Nacht. Es gibt einen Durchbruch vom Oberdeck ins Unterdeck, an der Stelle, wo im ersten Akt der Krater oder Trichter war. In diesem großen Schiffsbauch befinden sich unzählige Artefakte der Erinnerung. Es ist wie ein Wimmelbild von Resten seines Lebens. Dabei ist es wegen der Dunkelheit und der Vielzahl der Gegenstände eigentlich unmöglich, alles zu erkennen, das ist aber auch egal. Es geht um die Bedeutung des Bildes. Wie in der Traumdeutung oder Traumaarbeit werden die Tagesreste ins Unterbewusstsein verschoben und dort verdichtet. Tristan tritt auf und hat Schriftzeichen auf der Brust, analog zu Isoldes Kleid. Isolde findet in den Erinnerungsstücken Morolds Schwert, sie setzt es Tristan auf die Brust, kann aber den Hieb nicht ausführen und lässt es sinken. „Oh sink hernieder, Nacht der Liebe“ ist kein Duett, keine Liebesszene, eher ein Doppelmonolog. Das Wesentliche passiert wieder in der Musik, nicht zwischen den handelnden Personen. Kommentiert wird das Geschehen von Brangäne aus der Ferne „Einsam wachend in der Nacht“. Zentral im Schiffsbauch befindet sich eine Venus von Milo in einem goldenen Vogelkäfig. Tristan nimmt den Käfig weg. Die Liebesgöttin wird freigelassen. Eine sehr schöne symbolhafte Geste. Die einzige Liebesnacht, die Tristan und Isolde erleben, geht vorüber und Marke tritt auf. Melot hat Tristan verraten und Marke erwischt die Delinquenten in flagranti. Tristan schlägt mit der Faust in den alten Spiegel, in den er zuvor geblickt hat, er zerstört quasi das Objekt der Selbsterkenntnis, als könne er damit sein Handeln ungeschehen machen. Marke fragt ihn: „Tatest du's wirklich? Wähnst du das?“ Jetzt endlich trinkt Tristan den Todestrank. Isolde will ihm folgen, aber Melot entreißt ihr die Flasche. Er ist eifersüchtig auf Tristan, will selbst am liebsten Isolde für sich.
Dritter Aufzug
Wir befinden uns nun wieder auf dem Oberdeck des Schiffes, gleichsam in Kareol. Das Loch, der Krater im Deck, ist nun ein Vulkanschlot, aus dem die Relikte der Vergangenheit heraufquellen. Tristan liegt inmitten dieser Erinnerungsstücke und kann nicht leben und nicht sterben. Einmal noch muss er Isolde in die Augen schauen. Der Hirt wird zum Todesengel. Erst am Ende kommt Isolde und Tristan kann sterben. Ein zweites Schiff nähert sich. Marke kommt und Isolde trinkt den Rest des Giftes. Wenn man Tristan und Isolde inszeniert, muss man sich unweigerlich die Frage stellen: Was ist der Liebestod? Hier kommt es auf das Innere an. Isolde verströmt sich, entäußert sich, Tristan lebt für sie, er ist gar nicht tot in ihrer Empfindung. Die sparsame äußere und vielgestaltige innere Handlung findet wiederum und fortgesetzt ihren Ausdruck in der Musik. Örn Arnasson zeigt das Unsichtbare im Stillstand der äußeren Handlung, das muss man aushalten und sich davontragen lassen. Es ist wie ein Offsetdruck der Handlung, das Sichtbare ist nur das Gefäß des Unsichtbaren. Der Zuschauer kann sich darin meditativ versenken und mitnehmen lassen in einem akustisch-emotionalen Flow. Nach dem Jean Paul Zitat kann man nun noch Antoine de Saint-Exupéry anführen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Bühne und Kostüme
Die Bühne von Vytautas Narbutas bildet den Rahmen für die sichtbare Handlung. Oft als statisch kritisiert, bildet sie aber das Wesentliche aus dem Inneren der Figuren ab und gibt einen Rahmen oder eine Einordnung. Über weite Strecken, sehr sparsam ausgeleuchtet, richtet sie den Blick auf das Wesentliche oder Essenzielle. Das, was man erkennt, ist wichtig, was im Dunkeln bleibt, kann da auch bleiben, wir brauchen es nicht zwingend, um die Handlung zu verstehen. Narbutas arbeitet stark mit Andeutungen und Versatzstücken. Man erkennt auf den ersten Blick, was es ist. Durch die wenigen Taue, die aus dem Nichts der Bühnenmaschinerie kommen und auf dem Deck aufliegen, erkennt man sofort, dass wir auf einem Schiff sind. Mehr als ein paar Planken und Taue braucht es nicht. Im zweiten Aufzug gibt es etwas mehr Schiff, geschlossene Seitenwände und Spanten formen den Schiffsbauch, in dessen Tiefe sich die unzähligen Erinnerungsstücke befinden. Darunter ein Spiegel, ein Fuchs, die Venus von Milo, ein Schwert, ein Globus, Steuerräder, Skulpturen, Bilder, man kann sie gar nicht alle aufnehmen. Alle haben sie jedoch eine Bedeutung, sind Erinnerungen an Tristans früheres Leben. Im dritten Aufzug ist dieses Schiff weiter verfallen, es dringt ein wenig Licht von der Außenwelt in Tristans innere Welt. Dennoch ist für Tristan und Isolde ewige Nacht. Er liegt auf einem Stapel der Erinnerungen, die ihn von unten auf die Ebene der Lebenden hochgespült haben. Auch Isolde nimmt den einen oder anderen Gegenstand auf, betrachtet ihn und legt ihn wieder zurück. Mit der optischen Verwandlung des Schiffes geht parallel die Verwandlung von Tristan und Isolde einher. Zum Schluss sind einfach nur noch Trümmer und Einzelteile übrig, ihr Traum, ihr Ideal von ihrer Liebe, die sie nie leben können, ist auseinandergebrochen.

Die Kostüme von Sibylle Wallum unterstreichen die Idee der Bühne. Das bisweilen etwas manische Beschreiben des Hochzeitskleides erinnert an das Schreiben eines Tagebuchs. Isolde verarbeitet ihre Erinnerungen und Gefühle, indem sie alles aufschreibt, was sie nicht verarbeiten kann. Tristan sammelt seine Erinnerungen im Schiffsbauch, Isolde sammelt die ihren auf ihrem Kleid in einer Art Schreibtherapie. Brangäne trägt einen strengen dunkelblauen Hosenanzug und einen langen geflochtenen Zopf, Tristan eine dunkelweinrote Hose und ein ebensolches Hemd, im dritten Aufzug dann ein weißes Hemd, das ebenfalls mit Worten des Librettos beschrieben ist, König Marke ist ganz in Schwarz gekleidet mit einem prächtigen üppigen langen Mantel, Melot, Kurwenal, der Seemann erscheinen ebenfalls alle in Schwarz. Heraus sticht der Hirte, der engelsgleich weiße Gewänder trägt, bedeckt von einem langen weißen Fell.
Die besondere Wirkung des Lichts wird durch eine auf der offenen Bühne auf dem Boden stehende Anzahl von Natriumdampflampen erzeugt. Im Premierenjahr 2024 waren die Nebeleffekte noch deutlich stärker und haben eine dramatische und mystische Wirkung erzielt. Leider ist der Nebel im zweiten Jahr der Produktion fast vollständig verschwunden, was möglicherweise der Beeinträchtigung der Sängerinnen und Sänger geschuldet ist, da der Bühnennebel sehr stark auf die Stimme gehen kann und die Figuren sehr viel in Bodennähe und im Nebel agiert haben. Leider geht dadurch ein wenig dieser geheimnisvollen und düsteren Atmosphäre verloren und auch die besonderen Lampen verlieren ein wenig von ihrer Wirkung.
Gesungen wurde wie bereits im Premierenjahr auf hohem bis höchstem Niveau.
Der österreichische Tenor Andreas Schager gehört zu den Besten seiner Generation und seines Fachs. Auch als Tristan liegt ihm das Publikum im Festspielhaus erneut zu Füßen. Schagers Stärke liegt in seiner puren Kraft, diese großen Heldentenorrollen locker über die vier bis fünf Stunden durchzuhalten, ohne scheinbar zu ermüden. Es gelingt ihm scheinbar mit Leichtigkeit, den Spannungsbogen über alle drei Aufzüge zu halten. Mittlerweile bietet Schager auch leisere Töne an und verharrt nicht in nur einer Dynamik. Anrührend ist, wie er in seinen Erinnerungsstücken quasi Camouflage artig unsichtbar wird und das Spiegelbild zerschlägt, weil er nicht ertragen kann, was er darin sieht.
Camilla Nylund überzeugt als selbstbewusste und liebende Isolde. Ihr kräftiger, dramatischer Sopran verleiht der irischen Prinzessin eine gewisse Noblesse. Die Ausbrüche im ersten Aufzug meistert sie mit großer Souveränität, und sie ist ebenso in der Lage, sich die nötigen Reserven für den zweiten Aufzug, das Liebesduett „Oh sink hernieder, Nacht der Liebe“ aufzuheben. Sie hält die Frische und die Spannung bis zum Liebestod im dritten Aufzug aufrecht und zaubert mit großer Innigkeit und Hingabe berührende Momente des Abschieds.

Der aus Waidhofen an der Ybbs stammende Bass Günther Groissböck verleiht dem betrogenen König Marke eine finstere, fast dämonische Tiefe. Seine starke Bühnenpräsenz, gepaart mit seinem sonoren, voluminösen Bass, lässt das Publikum bei seinen bedrohlichen Auftritten im dritten Aufzug erstarren. Groissböck verkörpert glaubhaft die Enttäuschung über den Verrat Tristans.
Eine freudige Überraschung beschert der auf Oahu, Hawaii, geborene Bariton Jordan Shanahan als neu besetzter Kurwenal. Er löst im zweiten Jahr der Produktion den Isländer Olafur Sigurdarson ab. Shanahan ist dem Bayreuther Publikum bereits als Klingsor aus Jay Scheibs Parsifal bekannt. Shanahan interpretiert den treuen Freund Tristans mit seinem warmen und wandelbaren Bariton bei großer Spielfreude und guter Textverständlichkeit.
Die zweite Neubesetzung 2025 betrifft die Rolle der Brangäne. Nach Christa Mayer übernimmt in diesem Jahr Ekaterina Gubanova die Rolle von Isoldes Vertrauter. Gubanovas warmer runder Mezzosopran ist herzerwärmend innig. Sehr berührend klingen ihre Rufe „Einsam wachend in der Nacht“ aus der Brangäne-Klappe im Festspielhaus. Ihr unaufdringliches Spiel macht sie zu einer ebenbürtigen Partnerin an der Seite Isoldes.
Der junge Bassbariton Alexander Grassauer singt einen königstreuen Melot mit guter Textverständlichkeit und wohlklingendem Bariton.
Der deutsche Tenor Daniel Jenz, Preisträger im Bundeswettbewerb Gesang, interpretiert den Hirten mit eindringlichem Text und lyrischem Tenorklang.
Der junge Amerikaner Lawson Anderson singt nach seinem Debüt 2024 auch dieses Jahr wieder den Steuermann. Der junge Bass-Bariton beeindruckt durch gute Textverständlichkeit und ein warmes Timbre.
Besonders aufhorchen ließ erneut der in Illinois geborene lyrische Tenor Matthew Newlin als junger Seemann. Mit seinem wandelbaren hellen Tenor interpretierte er sehr anrührend die Rolle des jungen Seemanns.
Im zweiten Jahr der Produktion kehrt Dirigent Semyon Bychkov wieder an das Pult im mystischen Bayreuther Graben zurück. Unter seinem erfahrenen Dirigat lotete das wunderbare Bayreuther Festspielorchester die vielfältigen Farben der Tristan-Partitur aus. Besonders in Erinnerung bleiben die seelenvollen Vorspiele und der Liebestod. Besondere Erwähnung verdient das Englischhornsolo, das mit großer Sensibilität und endlos scheinendem Atem gespielt wurde.

Wenngleich Tristan und Isolde keine Choroper ist, sei dennoch ein Wort zum Chor erlaubt. Der Chor stellt das Schiffsvolk, Ritter und Knappen und Isoldes Frauen dar. Unter dem neuen Chordirektor Thomas Eitler de Lint erklingt ein dem Parsifal entsprechend verkleinerter Chor aus dem Off, sodass die Reduzierung der Chorstellen beim Tristan nicht so auffällt wie in anderen Produktionen. Der berühmte satte Chorklang muss sich in den nächsten Jahren erst wieder neu formieren, was unter Eitler de Lints erfahrener Chordirektion sicher gelingen wird.
Insgesamt zeigt Thorleifur Örn Arnarsson eine stimmige, sehr nach innen gerichtete Interpretation des Tristan in einer psychologisch zu deutenden, im ersten und dritten Aufzug etwas einfacher gehaltenen, im zweiten Aufzug extrem detailverliebt daherkommenden Inszenierung, die den Sängern Raum gibt, sich darstellerisch und sängerisch zu entfalten.
Das Publikum feierte die Solisten, den Chor und das Orchester sowie Semyon Bychkov mit lang anhaltendem Applaus.