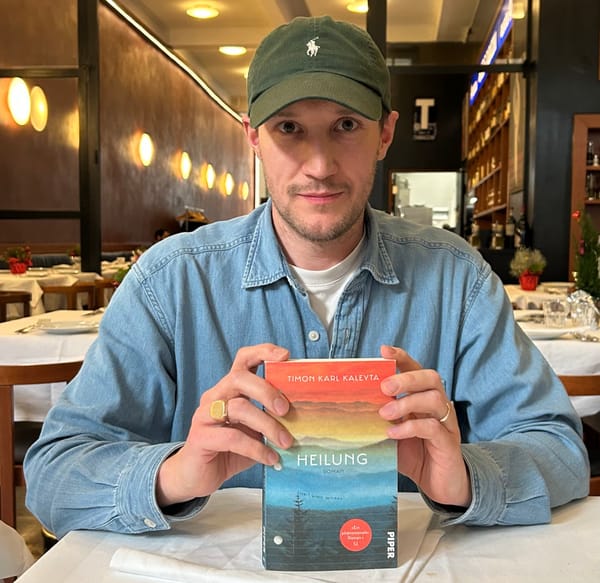Aix-en-Provence, Théâtre du Jeu de Paume, Billy Budd - B. Britten

05.07.2025
FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 2025
Oliver Leith / Ted Huffman: THE STORY OF BILLY BUDD, SAILOR (2025)
Kammer-Oper nach BILLY BUDD von Benjamin Britten in der Version in zwei Akten von 1964 nach einem Libretto von Edward Morgen Forster und Eric Crozier nach einer Adaption der Novelle von Herman Melville.
HOLZWANDIGE GOMORRAHS DER TIEFE…
Eine lodernde und dunkle Parabel…
Herman Melville (1819-1891), der Patriziersohn einer alten Boston-Dynastie, war erst zwanzig, als er 1839 von New York nach Liverpool segelte. Als gebildeter Schiffsmann entkam er dem Bankrott seiner Eltern. Seine Erlebnisse beschrieb er in Redburn: His first Voyage (1849), und präsentierte sich im Ausland als wohlerzogener Unschuldiger, schockiert über die zwielichtigen Seiten von Liverpool und die Komik der schlechten Manieren, die in solcher Armut gedeihen. Er empfand Redburn als ein armseliges Buch, das nur dazu diente, seine Familie zu ernähren und ihn mit Tabak zu versorgen. Doch die Reise ermöglichte ihm Erfahrungen, die über seine Schicht und Erziehung hinausgingen, auch über die seiner Leserschaft hinaus. Er entdeckte, dass ihm das Leben auf See lag und bald nach seiner Rückkehr stach er wieder in See, diesmal auf dem Walfänger Acushnet in Richtung Pazifik, wo er „die schreckliche Textur eines Gewebes, das aus Schiffs-Tauen- und Trossen gewebt sein sollte“, in sich aufnahm, wie er später in Moby-Dick (1851) über die Atmosphäre schrieb.

Wenn Moby-Dick sein Meisterwerk ist, so entstand ein weniger bedeutendes Buch aus dem Jahr, das Melville auf einem weiteren Schiff verbrachte, als er mit 24 Jahren als einfacher Matrose an Bord einer Fregatte der Vereinigten Staaten ging. White-Jacket (1850) ist eine eindringliche Schilderung des Lebens auf einem Kriegsschiff, eine Welt aus banaler und harter Arbeit, schöner Kriminalität, festgefahrenen Klassenhierarchien, unpassendem Gottesdienst, Auspeitschungen und anderer grober Ungerechtigkeit: Die allzu freizügig ausgeübt wird!
Melville schloss aus seinen isolierten Umständen eine tiefere Bedeutung, denn seiner Ansicht nach ist „ein Schiff ein Stück Land, das vom Festland abgeschnitten ist, es ist ein Staat für sich und der Kapitän ist sein König“. Er spickte White-Jacket mit kunstvollen Vergleichen um diese Doppelnatur der Erzählung zu unterstreichen. Er schrieb über die kleinlichen Streitigkeiten und die tief verwurzelten Klassenverleumdungen: