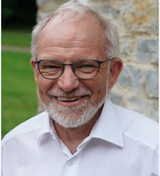Stuttgart, Staatsoper, I DID IT MY WAY – Nina Simone, Frank Sinatra, IOCO
Mit „I did it my way“ eröffnet die Staatsoper Stuttgart ihre Spielzeit ungewöhnlich: Ivo van Hove verbindet Songs von Nina Simone und Frank Sinatra zu einem neuen Musiktheater über Trennung, Emanzipation und Erinnerung – mit Lary, Lars Eidinger und einem glänzend aufspielenden Orchester.

von Peter Schlang
Versuch einer Erweiterung des Genres Musiktheater
An der Staatsoper Stuttgart erlebte „I did it my way“ seine Zweitpremiere
Am Freitag, 26. September eröffnete die Staatsoper Stuttgart ihre neue Spielzeit. Dies geschah nicht etwa mit der Neu-Inszenierung einer klassischen Oper oder einem „Repertoire-Schlager“, sondern mit einem „neuen Musiktheaterwerk“, das auf den Songs der amerikanischen Pop-Größen Nina Simone und Frank Sinatra basiert und diesen ein dramaturgisches Korsett verpasst. Mit „I Did It My Way“, einer Koproduktion mit der Ruhrtriennale und dem Faso Danse Theatre, startete die Stuttgarter Oper gleichzeitig eine Reihe von Kooperationen mit europäischen Festivals und Theatern, mit denen man neue Erzählweisen und andere Formen- und Klangsprachen im aktuellen Musiktheater vorstellen möchte. Auch sollen diese Produktionen den großen Facettenreichtum von dem ergründen, was Musiktheater heute sein und bieten kann.
Nach der Premiere bzw. Uraufführung in der Jahrhunderthalle Bochum am 21. August, bei welcher der Instrumentalpart von einer aus zwölf MusikerInnen bestehenden Band übernommen worden war, zeigte man in Stuttgart das Stück erstmals in der orchestrierten Fassung von David Menke und Boris Rogowski.
Inspiriert durch Frank Sinatras 1970 erschienenes Konzeptalbum „Watertown“ (Es wurde nach der Scheidung von Sinatras erster Ehe aufgenommen und stellt somit eine musikalisch-literarische Verarbeitung dieser Ehe und des darauffolgenden Solo-Alltags des Mannes dar.) und erweitert um Songs der Jazz- und Blues-Sängerin sowie Menschenrechtlerin Nina Simone, erzählt der belgische Regisseur Ivo van Hove, der auch der aktuelle Intendant der Ruhrtriennale ist, in „I did it my way“ die Trennungsgeschichte eines Paares, welche gleichzeitig die Emanzipationsgeschichte der Frau ist. Ein weiteres Argument für die Verknüpfung der Songs Simones und Sinatras liefert die Tatsache, dass der dem Abend seinen Titel gebende weltberühmte Song „I did it may way“, der übrigens ein thematisch gleiches französisches Chanson als Vorlage hat, auch von Nina Simone interpretiert wurde.

Als Darsteller des den Abend tragenden Paares bzw. als Interpreten der diesen zugeschriebenen Songs ging man sowohl für die Aufführungen in Bochum als auch für die aus drei Abenden bestehende Stuttgarter Serie ganz auf „Nummer sicher“ und hatte zwei sehr prominente und zugkräftige Künstler-Persönlichkeiten engagiert: Larissa Sirah Herden alias Lary - Sängerin, Schauspielerin und Musikproduzentin, die als prägende Stimme der deutschsprachigen Popmusik bestens als Brückenbauerin zwischen den an diesem Abend aufeinander treffenden Genres bzw. Musiksparten geeignet ist, und Lars Eidinger, einer der bekanntesten und profiliertesten deutschen Schauspieler seiner Generation. Damit erlebte das Publikum dieser Musiktheater-Produktion auch zwei weitere, „umgedrehte Premieren“, nämlich die der schauspielenden Sängerin und jene des singenden Schauspielers.
Der vom Autor und Regisseur Ivo Van Hove der Aufführung imaginierte und dem Abend unterlegte Plot ist so schnell erzählt wie banal: Eine Frau verlässt ihren Mann, der sie dominiert und an ihrer eigenen Entfaltung hindert. Beide kommen aber nie ganz voneinander los und kreisen in ihrer Erinnerung und Hoffnung um die gemeinsame Zeit und deren je nach Stimmungslage erhoffter oder drohender Fortsetzung. Das trägt dramaturgisch nur bedingt und äußerst kurzfristig, etwa wenn Larissa Sirah Herden als die von ihr verkörperte oder - besser - ihre Stimme gebenden Gattin das die ganze Bühne beherrschende amerikanische Mittelklasse-Holzhaus der Ostküstenstaaten (Bühne und Lichtdesign Jan Versweyveld) verlässt und dazu dort einige Kleidungsstücke zusammensucht und eilends in ein Köfferchen stopft.
Ansonsten machen die zwei Protagonisten als Sängerin und Sänger das, was Sängerinnen und Sänger auf einer Konzertbühne eben meistens machen: Sie singen dem Publikum und manchmal auch sich gegenseitig ihre Songs zu, und das ziemlich konzertmäßig.

Dabei sind die Lieder Sinatras überwiegend sehr persönlicher, biografischer Art und erzählen von den früheren und jetzigen Befindlichkeiten des Mannes. Lars Eidinger trägt sie mit klarer, kräftiger und im tieferen Bereich sonoren Stimme recht solide und ansprechend vor, dazu hörbar differenziert in Dynamik und Farbgebung. Allerdings kann er an manchen Stellen doch nicht verbergen, dass der Gesang, zumal in dieser Dichte, Länge und Anforderung, für ihn eine neue Erfahrung darstellt, wodurch manche Phrasen etwas hölzern und leicht mechanisch klingen.
Im Gegensatz zu den Watertown-Songs besitzen die von Larissa Sira Herden mit viel Soulblut und großer stimmlicher Intensität, Durchschlagskraft und subtiler Farbgebung interpretierten Songs Nina Simones (Die Sängerin kann hier ihre große musikalische Erfahrung stimmlich perfekt ausleben.) auch eine gesellschaftlich-politische Dimension und zeigen teilweise fast erschreckend aktuelle Parallelen zum gegenwärtigen Amerika Donald Trumps auf. Diese politische Seite wird auch durch eine etwas lange historische Videosequenz belegt, die aus den letzten Jahren der strengen Rassentrennung in den USA und der sie zementierenden Gesetze stammt und auch deren Bekämpfung und Überwindung durch Martin Luther King und die ihm folgende Bewegung zeigt.
Der Regie scheint irgendwann klar geworden zu sein, dass die direkte Übertragung handlungsarmer Texte auf eine Musiktheaterbühne nicht funktioniert und der Unterstützung durch eine wie immer aussehende Personenführung bedarf. Da sich aber auch diese nicht so ohne Weiteres aus den zugrundeliegenden Texten und deren Themen ableiten lässt, hält Regisseur Van Hove die beiden Protagonisten an, die von ihm vermutete Handlung durch mehr oder wenige ständiges Herumgehen und - vor allem im Falle Lars Eidingers bzw. des Mannes - durch eine Art akrobatischer oder semi-tänzerischer Einlagen zu verdeutlichen und ihr damit etwas Tiefe, Stringenz und Ausdruckskraft zu verleihen.
Unterstützung erfährt der Schauspieler-Sänger - und teilweise auch die Sängerin-Schauspielerin - durch die Choreografie Serge Aimé Coulibalys, welche zwei weiße Tänzer und zwei schwarze Tänzerinnen auf die Bühne bringt und an wichtigen Stellen dem Protagonisten und der Protagonistin an die Seite stellt. Allerdings wirken auch diese Szenen und die sie prägenden Bewegungen und Figuren der TänzerInnen des Faso Danse Théatre, Ida Faho, Sylvie Sanou, Marco Labellarte und Samuel Planas, auf den ioco-Betrachter über weite Strecken eher bemüht und etwas aufgesetzt-erzwungen. Auch wiederholen sich darin fast identische oder sogar immer gleiche Drehungen, Sprünge und Bewegungsbilder. Einen wirklichen Erkenntniszuwachs oder eine Erhöhung der dramaturgischen Spannung vermag man darin nicht zu erkennen. Stattdessen stellt sich auch hier alsbald eine gewisse Ermüdung, ja Langeweile ein.

Mögen die bisherigen Schilderungen von der Stuttgarter Saison-Premiere eher den Eindruck einer zumindest im Bereich der Dramaturgie und Regie mittelmäßigen Stadttheater-Produktion vermitteln, kann der ioco-Rezensent im Fall des Instrumentalparts in ein ganz anderes Register der Beschreibung und Würdigung wechseln. Das Staatsorchester Stuttgart unter Leitung des gerade einmal 32-jährigen Dirigenten Sebastian Schwab, der sich auch als Komponist bereits einen Namen gemacht hat und in Stuttgart schon mehrere Erfolge feiern durfte, findet an diesem Abend an seiner Rolle als „gehobenes Unterhaltungsorchester“ hörbar Lust und Freude und bringt den Graben des Stuttgarter Opernhauses zum Beben und den Raum darüber und davor zum Swingen. Egal, ob es in großer Besetzung als eher klassisches Orchester, als Big Band oder als Combo (Hier brillieren Christian Frentzen am Klavier und als Band-Leader, Philip Breidenbach an der Gitarre, Volker Kamp am Bass und Tim Dudek am Schlagzeug!) zu hören ist: Die Musikerinnen und Musiker spielen im wahrsten Sinn des Wortes ihre jeweilige Rolle mit größter Präzision, ungeheurer Musizierlust, mitreißender Dynamik und bewundernswertem Drive. Ja, das groovt stellenweise wie im besten Jazzklub, macht enorm viel klanglichen Spaß und lädt regelrecht zum Mit-Grooven und Tanzen ein. Um dies noch mehr genießen zu können, wäre es sicherlich reizvoll besser gewesen, das Orchester auf die Bühne zu setzen, besser noch zu stellen und Sängerin und Sänger davor oder in seiner Mitte singen zu lassen, denn die Szene wird an diesem Abend ganz klar von der Musik und dem Klang beherrscht oder sogar übertroffen, vor allem vom Instrumentalen. Auch wäre diese Produktion in einer dafür bestens geeigneten Club-Locations wie etwa dem Stuttgarter Wizemanns auf dem Pragsattel deutlich besser aufgehoben gewesen als im Opernhaus - in das allerdings viel mehr Leute passen. Und drei ausverkaufte Vorstellungen beweisen ja den Verantwortlichen der Stuttgarter Oper, einschließlich deren Marketing-Abteilung, dass sie im Hinblick auf den Veranstaltungsort durchaus richtig entschieden haben.
Dazu kommt die Vermutung des Rezensenten, dass sich nicht wenige der Besucherinnen und Besucher vor allem wegen der prominenten Besetzung des Parts der Sängerin und des Sängers ein Ticket für eine der drei Aufführungen gekauft hatten und vielleicht sogar zum ersten Mal im Stuttgarter Opernhaus geweilt haben.
Dahinter kann man dann auch die pädagogisch und kulturpolitisch äußerst lobenswerte und sehr verständliche Absicht vermuten, diese Gruppe behutsam an die „höhere Musikkultur“ heranzuführenund ihr die Angst vor diesem hehren Kulturtempel nehmen zu wollen.
Das Verhalten des gegenüber anderen Produktionen relativ alten Premieren-Publikums lässt annehmen, dass diese Rechnung einigermaßen aufgegangen ist. Allerdings waren die beobachtbaren Emotionen und Reaktionen hörbar zweigeteilt: Die beiden Solisten und das Orchester samt seinem Dirigenten wurden stark bejubelt, ja mit Ovationen überschüttet, während das Regieteam eher verhaltenen Applaus erntete und auch einige Buhrufe einstecken musste.
Die Aufführung am 28. September war nach Angaben der Intendanz der Staatsoper Stuttgart die letzte in dieser Spielzeit. Ob es in der nächsten Saison weitere Aufführungen geben wird, ist dem Rezensenten im Moment nicht bekannt.