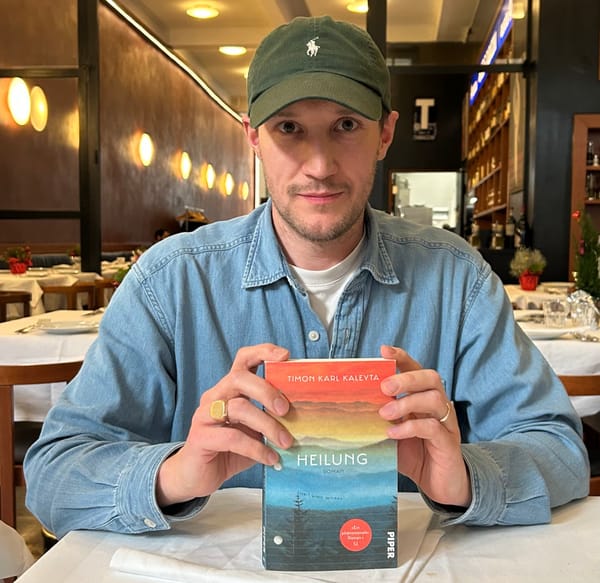Neubrandenburg, Konzertkirche Neubrandenburg, Klavierkonzert, IOCO

Grandioses für vier Hände und zwei Klaviere
Klavierduo Lucas und Arthur Jussen am 27.08.2025
Von Ekkehard Ochs
„Sonaten für vier Hände, sind Stücke, welche von zwei Personen auf der nämlichen Claviatur gespielt werden. Um sie ganz vollkommen darzustellen, sollte die Diskant- oder Gesangsstimme von einem Frauenzimmer, die Baßstimme von einer Mannsperson, vorgetragen werden. So wird das Stück in seinem natürlichen Charakter erscheinen.“
Vorstehendes ist zu lesen in Johann Peter Milchmeyers Schrift Die wahre Art das Pianoforte zu spielen, erschienen in Dresden 1797. Dies also in einer Zeit, in der Ensemblemusik auch am Tasteninstrument zu zweit, also vierhändig, längst im bürgerlich-häuslichen Musikleben festen Fuß gefasst hatte und innerhalb des letzten Drittels des 18. Jahrhunderts eine Blütezeit erlebte; als eine „Festung des Klaviers“, in der man ihre (des Bürgertums) „letzte Musik“ in „Wohnräumen behütete“, ehe diese Musiziertradition an den Konzertsaal verloren ging (Theodor W. Adorno, 1933). Das ist auch sozial aufschlussreich, denn hier wird gemeinsames Musizieren – gern unter klavierpädagogischem Aspekt (Liebhaber) – schon oder noch geschlechtsspezifisch definiert. (Milchmeyer charmant: man möge die Dominanz des Melodischen (rechts!) akzeptieren und dem Frauenzimmer etwas mehr Platz auf der Klavierbank einräumen). Eher weniger gedacht ist das Ganze wohl für das Musizieren an zwei Instrumenten - Orgel, Virginal/Cembalo, Klavier – das dann, so Arnfried Edler (2003), vor allem mit und seit Johann Sebastian Bach einem konzertant-sinfonischen Prinzip verpflichtet ist.
Liebhaber beider Darbietungsformen hatten kürzlich das große Vergnügen, deren kompositorische, pianistische wie interpretatorische Möglichkeiten am klingenden Beispiel erleben zu können. Dies im Rahmen der Festspiele MV. Tatort: Konzertkirche Neubrandenburg (27. August), „Täter“: das umwerfend musizierende und international hochgeschätzte Klavierduo Lucas und Arthur Jussen (Niederlande). Die beiden Pianisten hatten schon 2013 den Publikumspreis der Festspiele MV errungen, konzertierten inzwischen immer mal wieder „vor Ort“ und hinterließen hier auch kürzlich wieder den denkbar besten Eindruck. Dies als Duo vierhändig mit Mozart (Sonate C-Dur KV 521), Debussy (Six Épigraphes antiques L 131) und Fazil Say (Night) beziehungsweise an zwei Flügeln mit Schumann (Andante und Variationen B-Dur op. 46) und Rachmaninow (Suite Nr. 2 op. 17). Also mit einem Programm, dass es an spektakulärer spieltechnischer wie musikalisch hochambitionierter Attraktivität nicht fehlen ließ. Und das Ganze als in jeder Hinsicht überzeugendes Plädoyer für eine nicht eben häufig berücksichtigte Gattungsnische.

Was für ein Auftritt! Lucas, geboren 1993, Arthur, geboren 1996, beide seit rund 25 Jahren ein Bruder-Duo, dem man die totale gegenseitige Übereinstimmung in und mit jedem Ton anhört, ja fühlt, sie unmittelbar greifbar erscheinen lässt. Von Zusammen s p i e l sollte man da nicht reden. Eher von der Einheit eines Zusammenwirkens, das in seiner Komplexität nur auf Musikalisches zielt, und sich der Gedanke, dass dabei zwei Akteure am Wirken sind, gar nicht erst einstellt. Das ist wahrlich so verblüffend wie überzeuend. Eine stupende Technik – sie ist lediglich als Handwerkszeug erkennbar, notwendig nur als zweckdienlicher Wegbereiter eines zu erreichenden Zieles. Gleichwohl ist sie damit auch unabdingbare Trägersubstanz für Gestaltungsnotwendigkeiten und -absichten, mit denen die Brüder ihre Programme zu denkbar eindrucksvollen künstlerischen Manifestationen werden lassen. Ihr Spiel wirkt so selbstverständlich wie höchst artifiziell. Beide verfügen über einen Anschlag, der federnde Leichtigkeit und perlende Flüssigkeit mit prägnanter, charaktervoller Tongebung verbindet. Man „redet“, spannt Bögen, steuert Ziele an und schaffte es scheinbar mühelos, vom ersten Ton an zu fesseln und diese Verbindung nicht erschlaffen zu lassen. Stringenz heißt das Zauberwort, verbunden mit einem dynamisch ungemein variablen Pulsieren, einem permanent „provokativen“ Zwang zum aufmerksamen Zu- und Hinhören. Dabei ist die Spanne dieser Dynamik riesig, das „Vokabular“ an Ausdrucksqualitäten und -angeboten bemerkenswert. Und das ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass es sich – im Gegensatz zum solistisch angelegten Klavierwerk - beim Musizieren an einem beziehungsweise zwei Instrumenten um durchaus komplexer angelegte Kompositionen und damit um spezifischere Gestaltungsnotwendigkeiten und Wirkungsmöglichkeiten handelt.
Deutlich wurde das schon bei Mozarts spätem vierhändigen, einer Schülerin und Mitspielerin gewidmeten Werk KV 521 (1787), einem Stück, das er, leicht untertrieben, als „etwas schwer“ bezeichnete. Wie wahr gesprochen, denn an spielerisch anspruchsvoller Attitüde und gewichtiger kompositorischer Kunstfertigkeit bieten die drei bemerkenswerten, weit über die Grenzen bloßer „Hausmusik“ hinausgehenden Sätze ausgesprochen Bemerkenswertes; eine interpretatorische Fundgrube für die schon hier mit hinreißender Intensität, Expressivität und Lebendigkeit musizierenden und bekennenden Mozart-Fans Lucas und Arthur Jussen!
Bleiben wir beim vierhändigen Spiel: Debussys späte Six Épigraphes antiques von 1914. Aber was für eine andere Welt: hier die Brüder Jussen mit einem Riesenrepertoire an impressionistischen Klangbildern, um den sechs Szenen aus einer antikisierenden Dichtung Pierre Louys` gerecht zu werden. Eigentlich szenisch gedacht, geht es um eher symbolische Bildhaftigkeit, um Bukolisches, Nacht, Dunkel, Abgeschiedenheit, aber auch Tänzerisches, Lebendiges – Stoffe genug, um vielfältigen Ausdrucksbereichen etwa zwischen Schäfer-Idylle, verhangenem Nachtdunkel, tropfendem Morgenregen oder erotischem, kastagnettenbegleiteten Tanz auf klanglich höchst subtile, dynamisch äußerst verfeinerte Weise gerecht zu werden. Eine prachtvolle Studie exotisch betörenden, schwerelos scheinenden Klingens.
Wie anders Fazil Say in seinem zehnminütigen Stück Nacht. Hier dominiert harte Realität. Es ist ein Auftragswerk der Jussen-Brüder, auch wenn nicht einmal sie wissen, was es mit dieser „Nacht“ auf sich hat. Aber: Say ist ein politischer Künstler, mal einfach so komponiert er nicht. Und so liegt man wohl nicht ganz falsch, wenn sich die teils extreme Ausdrucksbereiche berührende Konflikthaftigkeit des Stückes mit persönlichen politischen Erfahrungen des kritischen türkischen Staatsbürgers Fazil Say in Verbindung bringen lässt; eine gewisse und wohl beabsichtigte „Bildhaftigkeit“ inbegriffen. Die allerdings nutzt in keineswegs modernem musiksprachlichen Rahmen sehr bekannte Ausdrucksmodelle, setzt vorwiegend auf äußerliche, meist sehr kraftvoll, ja teils brutal vorgetragene Passagen, ohne dabei einer gewissen Plakativität zu entgehen. Das Stück vermag zu verschrecken, ist aber ganz sicher individuell sehr ehrlich empfunden. Manches spräche allerdings auch für einen gewissen Mangel an (be)zwingender Inspiriertheit.
Für eine solche sorgten dann die beiden Werke für zwei Klaviere. Auch hier eine Zweisamkeit, die sich als klanglich grandiose Einheit präsentierte. Schumanns einziges Werk für diese Besetzung – ursprünglich für zwei Klaviere, zwei Celli und Horn! - geriet dem Duo zur mitreißenden Präsentation einer Variationskunst, die Hermann Abert 1903 als „vollendetste“ im Schaffen Schumanns bezeichnete. Da ließ man sich gern mittragen, auch forttragen und daran denken, was dem Komponisten nicht nur bei seiner Musik wichtig war: etwa „geheimnisvolle Kräfte des schöpferischen Vermögens“ oder der Hinweis, man müsse den Klavier s p i e l e r „ins Feuer werfen“, denn: „Nur, was aus dem Herzen kömmt, nur was innerlich geschaffen und gesungen, hat Bestand...“

Anwenden ließe sich solche Haltung auch auf Rachmaninow als einen weiteren, ganz spätromantisch-kraftvoll agierenden Komponisten, dem nicht zuletzt das Klavier – hier in Doppelbesetzung – bevorzugter Ausdrucksbereich war. In den vier Sätzen – Introduktion. Alla marcia/Walzer.Presto/Romanze.Andantino/ Tarantella/Presto – gelangten die Interpreten zur ganz großen Form. Da schienen die zweimal 88 Tasten beider Flügel gerade auszureichen, um einem unbändigen Willen zur meist furiosen Attacke auf Ohren und Verständnis des Hörers Ausdruck zu verleihen. Bravourstücke alle vier, schwindeln machendeVirtuosität, bange machende Akkordkaskaden und – nach gefühlstiefem Ritardando (3. Satz) – der orgiastische Taumel einer Tarantella – fulminanter, exorbitanter kann man kaum fürs Klavier/für Klaviere komponieren. Für die Brüder Jussen kein Problem. Ihre Souveränität beeindruckt genauso wie die Faszination und Glaubwürdigkeit ihrer Interpretationen. Im Saal applaudierte man lange und im Stehen.
Erwähnenswert die Zugabe: ein fast überiridisch zartes, elegisches, verklärtes, dabei überhaupt nicht kitschiges Arrangement der Arie „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ aus Bachs Matthäuspassion. Krönendes Moment auch dies – und ganz leise...