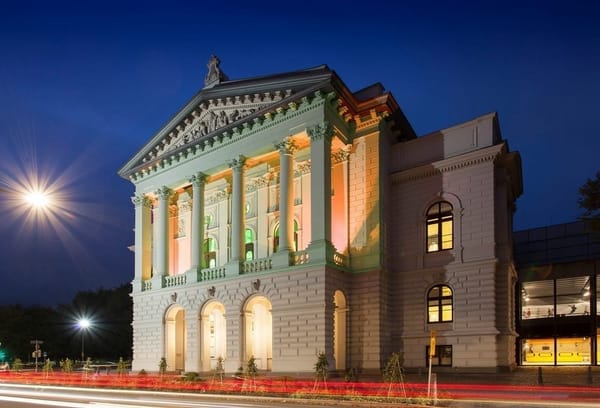Hamburg, Staatsoper, Das Paradies und die Peri - R. Schumann, IOCO

14. Oktober 2025 (Premiere 27. September 2025)
Das neue Leitungsduo Tobias Kratzer und Omer Meir-Wellber gab mit dem Robert Schumanns Oratorium „Das Paradies und die Peri“ seinen Einstand.
Die einfühlsame Regie, ein fantastisches Orchester und großartige Sänger machten den Abend zu einem großen Erfolg.
Robert Schumanns Oratorium „Das Paradies und die Peri“ ist ein Seelenstück, das mit den ersten Tönen emotional berührt. Durch Kratzers Betrachtungen zur Sehnsucht nach Glück und Frieden traf die Premiere den Nerv des Publikums und der Zeit.
Protagonistin der Handlung ist die Peri, eine Gestalt der persischen Mythologie. Sie sehnt sich nach dem Paradies. Als Halbwesen zwischen Engel und Mensch ist sie jedoch davon ausgeschlossen. Um trotzdem eingelassen zu werden, muss sie den Himmel erfreuen. Ihre Bitten, Einlass für die letzte Träne eines reumütigen Sünders oder das Blut eines Helden zu erhalten, werden abgelehnt. Erst als sie die reine Liebe eines unschuldigen Kindes findet, wird sie als würdig befunden, das Paradies zu betreten.
Für die eindringliche Vertonung dieser Geschichte war Robert Schumann prädestiniert. Sein früher Tod, aber insbesondere seine immer stärker ausbrechende psychische Erkrankung machten ihn, wie die Peri, zu einem Außenseiter. Lange stand er im Schatten seiner bekannteren und häufiger aufgeführten Kollegen. Zu Schumanns Musik fanden und finden viele keinen Zugang. Ein Grund mag Schumanns Verwendung einer Kombination aus komplexer Harmonik und emotionaler Intensität sein. Dies birgt neben erheblichen interpretatorischen Herausforderungen auch Schwierigkeiten für die Hörer, die sich auf die Struktur der Komposition einlassen müssen, um ihr folgen zu können.
In „Das Paradies und die Peri“ kombiniert Schumann liedhafte Melodien mit orchestralen und choralen Elementen. Die Komposition folgt nicht immer einer klaren, traditionellen Form, was die Orientierung und den Zugang erschwert. Schumanns Psyche könnte bereits in „Das Paradies und die Peri“ dazu geführt haben, dass er die ihm eigenen unkonventionellen harmonischen Wendungen und chromatischen Modulationen verwendete. Dafür stehen beispielsweise die dissonanten Bläserklänge in der zweiten Gabe oder in der Arie der Peri „O heil’ge Tränen“ und dem Finale.
Der Komponist und Dirigent Giuseppe Sinopoli, ein wesentlicher Anwalt und Kenner Schumanns, hat sich mit dem Zusammenhang von Kompositionsstil und Psyche Schumanns auseinandergesetzt. In einem Essay über Gesundheit und Krankheit in Schumanns Kompositionen hat er sich als Musiker und Arzt mit Schwerpunkt Psychiatrie mit Schumanns 2. Sinfonie auseinandergesetzt. Sie entstand fünf Jahre nach der Peri und stellt laut Sinopoli aus psychiatrischer Perspektive einen Spiegel von Schumanns geistiger Instabilität dar. Dieses Werk sah er als „auskomponierte Psychose“. Schumanns Kompositionen deutete er als Beginn eines Konflikts zwischen dem subjektiven Ich des Komponisten und den traditionellen Ausdrucksformen der Musik. Sinopoli sah daher die Erkrankung Schumanns als zentrale Komponente des schöpferischen Prozesses.
Die exaltierten Aufwärtsbewegungen und hypochondrischen Abstürze sind symptomatisch für die Musik Schumanns und auch für die Peri nach den Rückweisungen vom Paradies. Für das Verständnis von Peris Wesen, ihrer Befreiung von inneren Zwängen und welche Wirren der Weg bis in das Paradies bereitet, ist die szenische Umsetzung des Oratoriums ein entscheidender Faktor.

Vor Beginn der Aufführung werden Geschehen und Publikum gefilmt und auf einem herunterhängenden Bildschirm gezeigt. Der Erzähler Kai Kluge sitzt gleich einem Regisseur bei der Bühnenprobe an einem Laptop. Die leere weiße Bühne gleicht in ihrer Kargheit einem Industriebau und spiegelt das Innenleben der Peri. Sie liegt zu Beginn inmitten weißer Federn, die die Überreste ihrer Flügel sind. Diese hebt sie auf und berührt die offenen Wunden. Eine Vielzahl von Menschen läuft teilnahmslos an ihr vorbei und beginnt einen chaotischen Kampf. Leichen säumen die Bühne, und die Peri wird mit einem Eimer Blut übergossen. Dies nimmt eine Zuschauerin zum Anlass, zu protestieren und den Saal zu verlassen.
Im zweiten Teil treten Menschen in medizinischer Schutzkleidung unter Schutzzelten auf. Neben ihrem Geliebten, der vor der Seuche warnt, stirbt die Jungfrau. Ein Zuschauer verschläft in der Videosequenz diese Szene.

Im dritten Teil leben Menschen unter einer gläsernen Kuppel. Kinder spielen in einer heilen Welt. Plötzlich wird diese Welt durch Qualm verdunkelt und ausgelöscht. Die Menschen sterben, und ein Zuschauer beweint dieses Drama. Zu ihm steigt die Peri ins Parkett, über die Zuschauer kletternd, hinab. Sie sammelt die Tränen des weinenden Mannes und präsentiert sie dem Engel, der sie darauf ins Paradies einlässt.
Jeder Teil trägt in sich den Tod – entweder durch Krieg, Seuche oder Umweltzerstörung. Tobias Kratzer setzt Schumanns Werk als Miniaturmalerei dieser Krisen um. Stets ist auch das Publikum betroffen. Die Frau, die den Saal verlässt, will nicht sehen, dass die Peri mit Blut übergossen wurde, weil das nicht in die Oper gehöre. So verneint sie die Wirklichkeit, erinnert an die letzte Hamburger Trovatore-Premiere mit ihren Buhrufen nach der Vergewaltigungsszene und verneint die Toleranz für Kratzers Bilder, die das Werk erläutern sollen. Sie und der schlafende Zuschauer sind Symbole der Intoleranz.
Bühne und Publikum sind erst mit dem weinenden Mann zusammengewachsen, der das Ende der Welt beweint. Kratzer schafft es, auf unvergleichlich dichte Weise aus Schumanns Werk in unserer Zeit zu transformieren und mit ernsten Mahnungen für Kunst und Zuschauer zu versehen.

Mit den Fragen, ob die Peri das Paradies gesucht hat, um der Welt zu entfliehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat oder ob alles nur ein Traum war und die Peri in ihren Chor zurückkehrt, geht der Zuschauer nach Hause. Drei Botschaften waren klar: Schlafen lohnt sich in dieser Inszenierung nicht, Mitgefühl macht uns zu Menschen, und in der Hamburgischen Staatsoper werden Emotionen geweckt. Eine große Regieleistung, die immense Spannung vermittelt und zum Nachdenken anregt.
Musikalisch war die Aufführung auf höchstem Niveau. Omer Meir-Wellber leitete das Orchester fein austariert mit Sensibilität und Energie. Sein frischer, dynamischer Ansatz tat Schumanns Musik gut. Dunkle Streicherfarben, fließende Melodien und zupackendes Dirigieren sowie das exzellente Orchesterspiel machten schon für sich allein den Abend zum Genuss. Zu Recht wurden Dirigent und Orchester beim Erscheinen auf der Bühne mit frenetischem Applaus bedacht.
Vera-Lotte Boecker war eine hinreißende Peri. Ihr klangschöner, leuchtender Sopran bewältigte die Partie mit großer Hingabe und künstlerischer Meisterschaft. Kai Kluges Erzähler glänzte mit fulminantem Tenor, betörendem Schmelz und vitaler Intensität. Die Jungfrau von Eliza Boom überzeugte durch ihren leuchtenden und sicher geführten Sopran. In der Mezzosopranrolle überzeugte Kady Evanyshyn mit dunklem, rundem Ton. Annika Schlichts Alt war von schönem Klang. Christoph Pohl überzeugte in den Baritonrollen mit seinem unglaublich schönem, runden Organ und seiner Durchschlagskraft. Ivan Borodulin punktete mit seinem strahlenden Countertenor. Lunga Eric Hallams klangschöner Tenor rundete das Ensemble ab.
Der Chor der Hamburgischen Staatsoper unter der neuen Direktorin Alice Meregaglia war beeindruckend in seiner Polyphonie und durch die darstellerische Wucht.
Kratzers Inszenierung rückte Schumanns Werk in ein nachdenkliches, vielschichtiges Licht. Ein großer Abend und ein ausgezeichnetes Omen für Kommendes. Wer an Schumann oder der Hamburgischen Staatsoper zweifelt, wird bekehrt. Unbedingt hingehen. Wer das nicht einrichten kann, findet die Übertragung auf arte.tv.