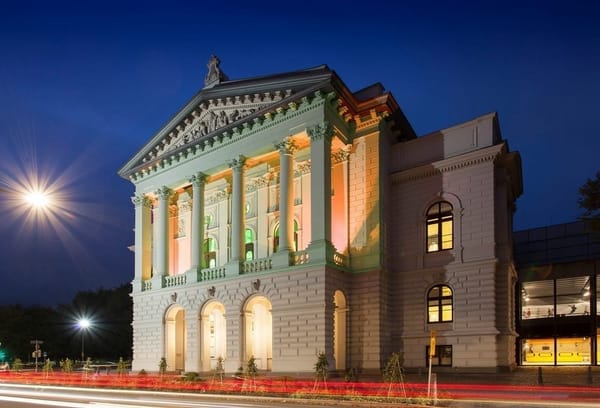Bayreuth, Bayreuther Festspiele, SIEGFRIED – Richard Wagner, IOCO
Valentin Schwarz inszeniert Wagners Siegfried in Bayreuth als packendes Psychodrama mit ungewöhnlichen Bildern. Simone Young entfaltet die Partitur mit Klarheit und Spannung – ein Abend voller musikalischer Strahlkraft und szenischer Intensität.

von Ingrid Freiberg
Siegfried ist das „jugendlichste“ Werk der Tetralogie, in dem die Orchestersprache von Richard Wagner sich zur vollen Reife entfaltet. Die Unterbrechung der Komposition nach dem ersten Aufzug, in der er Tristan und Isolde und Die Meistersinger schrieb, dauerte über ein Jahrzehnt und führte zu hörbaren stilistischen Brüchen. Das Netz der „Leitmotive“ ist in Siegfried besonders dicht, sie wurden aus Rheingold und Die Walküre weiterentwickelt bzw. erklingen neu: „Das Schmiedemotiv“, in energisch punktierter Rhythmik in den Blechbläsern, das „Siegfried-Motiv“, hell, strahlend, von Hörnern getragen, ein Amboss dient als Schlaginstrument, das bedrohliche „Drachenmotiv“ von Blech und Kontrabässen bestimmt und das filigrane in Orchesterfarben aufblühende „Waldweben“. Die „Erweckung Brünnhildes“ steigert sich in lyrisch-expressiven Bläserlinien bis zum ekstatischen Schlussduett. Das Orchester erhält eine betont zentrale Rolle, es erzählt mythische Vorahnungen. Geht der Vorhang auf, ist sofort zu spüren: In Siegfried betritt man eine andere Welt. Während Das Rheingold und Die Walküre stark von Göttern und deren Intrigen geprägt sind, verlagert sich der Fokus auf den jungen Helden Siegfried. Wotan erscheint als Wanderer in einer zurückgenommenen Rolle. Musikalisch geht es stellenweise märchenhaft-komisch zu; es wird dialogischer, mit einer Prise Humor gewürzt.

Siegfried zwischen Kindheitsfragmenten, seelischer Zerrissenheit und musikalischem Triumph
Valentin Schwarz (Regie) zeigt Siegfried als Produkt einer beschädigten Kindheit. Ein Kinderzimmer voller Puppen und ungeordnetem Sammelsurium ist die Werkstatt Mimes, eine Welt, in der aus Spiel Schmerz wird. Mime ist nicht der listige Nibelung, sondern ein tragisch-komisch-zerrissener Erzieher, der Kasperletheater spielt. Eine Puppe, die Sieglinde ähnelt, ein Aquarium, eine Girlande zum nie gefeierten Geburtstag: Das alles sind Fragmente, in dem Siegfried weder Herkunft noch Zukunft findet. Im 2. Aufzug verlagert sich das Geschehen in einen Salon, mehr ein Wartezimmer der Macht als mythischer Wald. Fafner ist kein Drache, sondern ein gebrechlicher alter Mann auf dem Sterbebett. Siegfried tötet ihn, indem er ihn mit dem Rollator umstößt und damit sein Leben auslöscht. Anstatt einer heroischen Kampfszene ist dieser Tod schockierend banal. Zeuge ist der stumme Hagen, eine wichtige Figur im Kontext der Regie, ein komplizenhafter Mittäter, in dem bereits die Saat seines Verrats in der Götterdämmerung keimt. Die Regie bleibt dabei mehr andeutend als erzählend. Sie deutet Mythos als Trauma. Wer hier Märchen erwartet, erhält eine Parabel auf Verlorenheit und männliche Selbstüberhöhung.
Die teilweise bewusst alltäglich gestaltete Bühne von Andrea Cozzi zeigt die „Höhle von Fafner“ grotesk, entmystifiziert als steriles Krankenzimmer. Der Regie entsprechend wird der Drache, völlig fremd wirkend, nicht als Ungeheuer, sondern als Pflegefall gezeigt. Die Bühnenausstattung erinnert an Reality-TV-Ästhetik. Sein Konzept ist ein sozialer Kommentar, modern, provokant und atmosphärisch dicht. Auch die Kostüme von Andy Besuch zeigen einen auffälligen Bruch mit mythologischem Pathos. Sie sind modern, realitätsnah und integraler Teil der zeitkritischen Inszenierung: Statement, nicht kosmetisches Beiwerk.

Tiefe und leuchtende Höhepunkte
Klaus Florian Vogt interpretiert Siegfried mit seiner hell geführten, mühelos strömenden Stimme als Suchenden und Fragenden. Er glänzt in den lyrischen Momenten und lässt Verletzlichkeit durchscheinen. Die Schmiedelieder geraten ihm etwas verhalten, hervorragend gelingt ihm in der „Erweckung Brünnhildes“ innige Balance aus Staunen und Aufbegehren. Catherine Foster bleibt eine Idealbesetzung der Brünnhilde. Klar in der Höhe, warm im Timbre, mit einer Ausstrahlung, die Würde und Menschlichkeit verbindet. Das Schlussduett mit Vogt entwickelt sich zu einem Rausch musikalischer Verklärung. Ya-Chung Huang als Mime besticht durch Spielfreude, klare Diktion, eine gefährlich einschmeichelnde Stimme und mit überzeugender körperlicher Präsenz. Er gerät nie zu einer Karikatur, sondern beeindruckt als tragischer Intrigant. Tomasz Konieczny verkörpert den Wanderer mit imposanter Stimmgewalt, besonders ideal für die ziemlich hohen Passagen, aber auch mit berührender Müdigkeit. Der Abgesang des Göttervaters gelingt ihm als Studie einer erschöpften Autorität, ist psychologisch dicht. Ólafur Jóhann Sigurðsson überzeugt als zynisch-verrohter Alberich mit klarer Diktion, markantem Auftreten, menschlich wild und doch verletzlich. Er ist eine Idealbesetzung … Tobias Kehrer ist ein düster charismatischer Fafner. Sein Bass ist finster,bedrohlich, imposant, sicher im Ton und angenehm im Klang. Anna Kissjudit gewinnt als stimmlich kraftvolle, würdevoll resignierende Erda von textlicher Prägnanz. Ihre warme Altstimme, stimmliche Schönheit und emotionale Tiefe bleiben nachhaltig haften. Victoria Randem als Waldvogel bezaubert mit kristalliner Leichtigkeit. Ihr Gesang ist ein unschuldiger Klang in einer ansonsten beschädigten Welt. Ihr Zusammenspiel mit Siegfried ist liebenswert frech. An ihrer Artikulation muss sie allerdings arbeiten. Branko Buchberger verkörpert den jungen Hagen als wortlosen Schatten im Hintergrund, als stillen Beobachter mit zunehmend spürbarem Eigenwillen. Seine Interaktion mit Siegfried wirkt zunächst wie eine aufrichtige Freundschaft, doch das Spiel verrät früh den Keim seiner Kränkung. Buchbergers zurückgenommene Körpersprache gibt der Figur Tiefe und Bedeutung. Nicht weniger eindrucksvoll ist Igor Schwab als Ross Grane. Er ist nicht nur stummer Begleiter, sondern „Schutzengel“. In seiner subtilen Interaktion mit Brünnhilde schwingt zugleich Loyalität und stille Eifersucht mit. In einem kurzen, beinahe tänzerischen Streit mit Siegfried um die Gunst Brünnhildes gelingt es Schwab, dramatische Spannung zu erzeugen. Diese beiden stummen Rollen sind nicht nur stilistische Raffinessen, sie sind integraler Bestandteil des psychologischen Spannungsbogens. Dass sie in Erinnerung bleiben, spricht für die Kraft der Regie und für das eindrucksvolle Spiel der beiden Darsteller.

Das Festspielorchester mit leuchtender Präzision, seelisch verdichtet
Eine weitere Heldin sitzt im Graben: Simone Young führt das Festspielorchester mit klarer Linie und feinem Gespür für Spannung und Entladung. Ihre Lesart des Siegfried ist kein rauschhafter Klangraubzug, sondern eine organisch atmende, durchdachte Erzählung. Young lässt die Musik ohne Pathos sprechen. Die Tempi sind kontrolliert, besonders das „Waldweben“ gerät ihr zu schwebender Poesie. Harfenglissandi glitzern wie Lichtreflexe auf dem Wasser, während die Holzbläser einen atmenden Kontrapunkt setzen. Bei den dramatischen Höhepunkten entfesselt sie die ganze Fülle des Orchesters: Die Hörner strahlen, das Blech bleibt geschliffen, kraftvoll, die tiefen Streicher tragen die Bögen mit Wärme und Gravität. Und über allem liegt eine Ruhe und Souveränität, die deutlich macht: Diese Dirigentin weiß genau, was sie will.
Das Publikum ist hingerissen und bedankt sich mit donnerndem Applaus bei allen Mitwirkenden.