Oldenburg, Staatstheater, IL TRITTICO - G. Puccini, IOCO Essay
Oldenburgisches Staattheater: Wir haben Puccini-Jahr (100. Todestag), wir haben das Finale der Opernsparte am Oldenburger Haus und es ist die letzte Musiktheaterproduktion der Ära Christian Firmbach. Das lässt man sich im übertragenen wie im Wortsinn etwas kosten: Il Trittico.

Trittico mit Luftballons – drei Opern zum Finale - Einlassungen zur Premiere von Puccinis Il Trittico - Oldenburgisches Staatstheater - 20. April 2024
von Thomas Honickel
Wir haben Puccini-Jahr (100. Todestag), wir haben das Finale der Opernsparte am Oldenburger Haus und es ist die letzte Musiktheaterproduktion der Ära Christian Firmbach. Das lässt man sich im übertragenen wie im Wortsinn etwas kosten: Il Trittico.
Das Triptychon aus dem Jahr 1918 ist Puccinis opus ultimum, sein letztes vollendetes Werk, dem dann in den 20er Jahren noch die erheblich unvollendete Turandot folgte.
Soviel vorweg
Mit dreieinhalb Stunden (inklusive zweier in vielerlei Hinsicht nötiger Pausen) ein äußerst kurzweiliger Opernabend, der eintauchen lässt in ein Eifersuchtsdrama an den Landungsbrücken der Seine, das mystisch aufgeladene Schicksal einer Nonne und ins Florenz der Spätrenaissance, wo ein gewiefter Stratege eine komplette erbschleichende Familie übertölpelt. Eine in allen drei Werken überraschend homogene und teilweise zu außergewöhnlichen Hochleistungen befähigte Sängerschaft trug diesen Abend wie auf Flügeln.
Wenige Abstriche sind zu vermerken bei den drei durchaus sehr verschiedenen Regiehandschriften sowie (leider erneut) bei der Dynamikabstimmung zwischen Graben und Bühne.
Zurecht ein anhaltender und enthusiastischer Premierenjubel vom Parkett bis in die Ränge, der die finale Produktion dieser Saison und der laufenden Intendanz in bester Erinnerung belässt.

Puccini und Trittico
Mit einem musikalisch gewinnenden Werk, das gleichzeitig mannigfaltige Einblicke ins Allzumenschliche gewährt und das mit extrem zahlreicher Personnage (wir haben nachgezählt: Es sind nahezu 40 Rollen in allen drei Werken) und trotz tatsächlicher Länge von nahezu vier Stunden überaus kurzweilig daherkommt, mit einem solchen Opus also die Sparte zu finalisieren, rundet die Arbeit einer Dekade prachtvoll ab.
Das Ansinnen von Librettist und Komponist, in drei völlig disparaten Werken Schlaglichter auf die menschliche Seele und damit Auszüge aus den Todsünden auf die Bühne zu stellen, ist frappant und in der Kompaktheit der einzelnen Studien von enormer Schlagkraft:
Im Verismo-Drama Il tabarro (Der Mantel) sind es Eifersucht, Wollust und Zorn (und am Ende ein Mord), in der klösterlichen Studie Suor Angelica finden wir Hochmut, Bigotterie und Missgunst (mit einem Freitod) und in Gianni Schicchi (einer Figur aus Dantes Göttlicher Komödie) erleben wir Geiz, Selbstsucht, Faulheit und Neid (da ist der Todesfall zu Beginn Ausgangspunkt für das turbulente Treiben). Eine brisante Mischung das alles!
Giuseppe Adami (Il tabarro), Giovacchino Forzano (Suor Angelica und Gianni Schicchi) lieferten die Vorlagen, die Puccini dann treffsicher und nachdrücklich musikalisch formte. Das Ansinnen, an einem Abend ein tragisches, ein lyrisches und ein komödiantisches Stück darzustellen, war die zentrale Intention Puccinis.
Alle drei Opern finden nahezu kammerspielartig in einer monochromen Szenerie statt: Auf einem Schleppkahn an der Seine, in einem Kloster und im Haus des reichen venezianischen Erblassers Signore Buoso Donati. Innerhalb der Werke keine Umbauten, kaum Szenenwechsel, wenig Bewegung im Äußeren. Dafür konzentriert sich das Geschehen gänzlich auf die Akteure, die auf sich und ihre inneren Motivationen zurückgeworfen sind. Hier darf dann jedes einzelne Ensemblemitglied nochmals glänzen, bevor sich der Vorhang für die Opernsparte dieser Intendanz senkt. Da bleiben keine Fragen offen!
Wege zum Werk – Chancen und Risiken
Interessant beim Trittico bleibt stets die Frage der Reihenfolge, die Puccini nicht bis ins Letzte verabschiedet hat. Da konnte man republikweit schon Varianten erleben. Üblich ist die Reihenfolge Il tabarro – Suor Angelica – Giannis Schicchi, also Tragödie, religiöse Lyrik und Komödie. So hält man´s auch in Oldenburg (im religiösen Triptychon steht ja auch das Madonnengemälde stets in der Mitte).
Immer wieder gibt es auch den Versuch, die drei Werke in einer dramaturgisch sinnfälligen Form aufeinander zu beziehen, sie in einen größeren Kontext zu betten. Jüngst vor einem guten Jahr geschah dies an der Hamburger Staatsoper, indem man eine Rahmenhandlung entwickelte, welche die drei Opern als Schlaglichter auf die Entwicklung einer Person deutete. Der Regisseur Axel Ranisch erfand die teilweise als hanebüchen empfundene Rahmengeschichte einer fiktiven Schauspielerin, deren Aufstieg (Gianni Schicchi), Absturz (Il tabarro) und Tod (Suor Angelica) in den drei Opern erzählt wird; dabei kamen dort vor allem filmische Mittel und alternative Erzählstrukturen (Videoeinblendungen etc.) zum Einsatz.
Der Aufschrei war groß, die Inszenierung stand auf der Kippe; aber interessant war der Ansatz allemal. Bleibt also stets aufs Neue bei diesem Opus die Frage, ob es als durchgängiger Roman oder als Buch mit voneinander verschiedenen Novellen gelesen und dann entsprechend verortet werden soll.
Man sieht so immerhin, wieviel Inszenierungspotential in den drei Werken liegt. In Oldenburg wird das Ganze separiert und folgerichtig in die Hände von drei verschiedenen Regisseuren gelegt. Das zeichnet den Abend noch klarer in der Unterschiedlichkeit der handwerklichen Stilistiken.

Heerscharen für drei Einakter
Die übergroße Gesamtbesetzung verhindert bis heute eine Etablierung des Triptychons im Repertoire. Der Liebling aller Operndirektoren ist die einzige Komödie aus der Feder Puccinis Gianni Schicchi, die oft als Solitär inszeniert oder mit anderen Werken kombiniert wird. Diese Komödie ist tatsächlich alleine lebensfähig und leuchtstark, was man vom deprimierenden Il Tabarro und der überaus melancholischen Suor Angelica nicht unbedingt behaupten kann.
Während der Covid-Epidemie gelangten viele kleindimensionierte Werke des Musiktheaters auf die Bühne; so auch in Oldenburg der Gianni Schicchi, den man damals mit Ravels L´heure espagnole kombinierte. Beides Werke ohne Chor, weil das Singen in größeren vokalen Gruppen während der Pandemie nicht möglich war. Diese Inszenierung von Gianni Schicchi aus der Feder von Tobias Ribitzki wurde nun generalüberholt wieder aufgenommen und erstmals in den Reigen der beiden anderen gestellt, was der Inszenierung spürbar gut und besser tut. Sie ist naturgemäß durch die Wiederaufnahme die reifste von den drei Darstellungen.
Mathilda Kochan, lange Jahre als Regisseurin und Regieassistentin am Oldenburger Haus, ist die kreative Kraft bei Il tabarro und Tom Ryser, der am Haus bereits Verdis Falstaff und Brittens Sommernachtstraum für die Bühne bildmächtig herstellte, zeichnet für Suor Angelica verantwortlich.
Drei Regie-Handschriften, die einen intensiven und nachdrücklichen Abend verheißen sollten. Zumal das verbindende Element durch die gestalterische Kraft eines gemeinsamen Bühnen- und Kostümbildners darstellt wird: Stefan Rieckhoff, seit langen Jahren Garant für Ausstattungen (Bühne und Kostüme), welche die inszenatorischen Impulse aufnehmen, befördern oder gar initiieren.
Ein Wort noch zur schieren Masse der eingesetzten Sängerschaft: 37 Rollen zählt Il Trittico. Bei einem etatmäßigen Ensemble am Haus von derzeit 16 Stimmen, von denen alleine vier gar nicht zum Einsatz kamen, bedeutet das für Oldenburg einen nicht unerheblichen Einsatz von Gästen, von Solostimmen des Opernchores und von Mehrfachnennungen am Abend, wo eine Stimme dann in gleich zwei Opern zu hören war, zu hören sein musste. Manch Name erscheint in Doppel-besetzung gar in allen drei Einaktern.
So gilt zu allererst der Dank all diesen Menschen, die sich mit wandlungsfähigem Spiel und variantenreicher Stimme für das Opus einzusetzen wussten. Und das schließt unbedingt auch alle Gewerke ein, die in Rekordzeiten in zwei Pausen drei völlig verschiedene Bühnensituationen herstellen sowie Massen an Akteuren umkleiden und umschminken mussten.
Die Inszenierungen und die Bühne
Drei Handschriften, die sich bewusst voneinander abgrenzen, prägen diesen Abend. Eine Dame und zwei Herren, die die Aufgabe angenommen haben, diese Opernminiaturen zum Leuchten zu bringen. Interessant und aufmerksamkeits-heischend, dass alle drei Werke über dem sich öffnenden Vorhang lautlos beginnen.
Mit teils weniger als 60 Minuten Laufzeit ist es eine Herausforderung, eine Erzählung vorzunehmen, die größere Bögen zu spannen versucht. So gilt es, von Anfang an die Energie der Szenen zu erfassen und auf den Plot zu steuern. Die schnelle Endlichkeit der drei Kurzwerke nötigt Präzision, klare Personenführung und maximale Stringenz ab. Der Schlussstrich der Partitur droht!
Gianni Schicchi
Das gelingt naturgemäß beim (vermeintlichen) „Hit“ des Tryptichons Gianni Schicchi am schnellsten, denn man ahnt schon in der Eröffnungsszene, was der raffgierigen Sippschaft droht. Dazu die anrührende, parallel geschaltete Lovestory von Lauretta und Rinuccio, die dem Titelhelden am Ende das Recht verleiht, sich ans Publikum zu wenden: Es war doch alles Recht so, oder?
Die Ausstattung mit riesigem Durchblick auf den Dom von Florenz ist optisch verortet in einer namenlosen Vergangenheit mit präzise die Charaktere nachzeichnenden Kostümen und einem Schlafgemach des dahingeschiedenen Donati, das allerlei Optionen für humoristische Einlagen ermöglicht; angefangen von der Standuhr, wo sich der jüngste Spross ständig versteckt oder die Leiche Donatis während der Notar-Szene zwischengelagert wird, bis zum Lüster, an dem die hochschwangere Nella hilflos durch den Saal pendelt.
Die bereits aus der Corona-Zeit vertraute Inszenierung von Tobias Ribitzki (damals mit Ravels Blauer Stunde kombiniert) hat nichts von ihrem Humor, ihrer Bissigkeit, ihrer unaufhaltsamen Zielstrebigkeit und ihrer nahe am Slapstick orientierten Handschrift verloren. Sie versöhnt das durch die ersten beiden Werke des Abends emotional stark mitgenommene Auditorium mit Heiterkeit, Lauterkeit und einer brillanten Teamleistung, die zu Hochform aufläuft. Da fliegen die Fetzen, wird verlogen und missgünstig intrigiert, erlebt man den florentinischen Klassenkampf der Donatis und Schicchis, zwischen denen, Romeo und Julia im Geiste verwandt, Schicchis Tochter Lauretta und Rinuccio von den Donatis scheinbar aussichtslos zerrieben werden könnten, und die teilweise außerhalb dieser Fehde (in der Intendantenloge) agieren.
Wie herrlich, dass Puccini wenigstens eine augenzwinkernde Komödie geschrieben hat! Dabei hat er sich übrigens gegen den Chef von Ricordi durchgesetzt. Der Verlag hatte sich bis zum Tode des Seniorchefs 13 Jahre lang gegen den Plan des Trittico gesträubt.
In Oldenburg ist das Ensemble der unbestrittene Star! Aus ihr ragt, naturgemäß, der Charakterbariton Donato di Stefano als Titelfigur hervor; aber auch das Liebespaar weiß mit innigem Spiel und frappierenden Stimmen zu überzeugen.

Suor Angelica
Das klösterliche Drama Suor Angelica mit der vermutlich schon zu Puccinis Zeiten höchst antiquierten Geschichte um eine Nonne, die wegen der „Schande“, die sie ihrer adligen Familie durch eine uneheliche Schwangerschaft „zumutete“, ins Kloster gesteckt wurde, ist der Mitte des Abends anvertraut.
Die Ausstattung hätte die Kargheit des klösterlichen Lebens nicht spartanischer darstellen können. Auf einer riesigen Kreisfläche im antiseptischen Weiß wandern die zwölf geistlichen Frauen nahezu die gesamte Distanz des Werkes im Uhrzeigersinn. Am Ende dürfte das zurückgelegte Marschtempo gewiss ein nicht unerhebliches Kilometergeld abwerfen. Irgendwann wird einem auch im Publikum einigermaßen wirr im Kopf durch die permanente Kreislaufbewegung der Klosterformation, die von vielem ablenkt.
Kein einziger Moment des Innehaltens, weder bei der einzigen dramatischen Zuspitzung während Angelicas Begegnung mit der Fürstin, die ihr die Unterschrift zum Abtritt ihres Erbes für die jüngere Schwester abtrotzt, noch bei der zentralen Arie der Angelica, in der sie ihr Schicksal beweint, ihren Sohn nie wiedergesehen zu haben; den Sohn, der ihr genommen wurde und als Kleinkind verstarb.
Da verschenkt die Regie unter Tom Ryser viel Potential. Fast hat man den Eindruck, als könne der Spielleiter mit der Thematik der religiösen Welt, der Isolation der Ordensfrau und den geistlichen Visionen der Habit-Trägerin nichts anfangen. So bleibt selbst im Finale, wo in einer spirituellen Vision ihr Kind erscheint, das ganze erschütternde Geschehen irgendwie teilnahmslos und distanziert.
Rysers Absichten mögen noch so aufrichtig und nachvollziehbar sein (im Programmheft deutet er die Choreographie als Unerbittlichkeit und Gnadenlosigkeit des religiösen "Betriebs" an); letztlich inszeniert er gegen die Partitur und ihre facettenreichen Details. Der knapp einstündige Kreisgang der Klosterfrauen kommt dem von Insassen im Innenhof eines Gefängnisses nahe, vermutlich so auch intendiert. Wer aber selbst auch Klausurorden besucht hat, weiß um die häufig hohe Spiritualität und starke soziale Bindung dort. Das in Suor Angelica vermittelte ordenskritische Bild der Inszenierung hält, mindestens was meine Erfahrung betrifft, der Wirklichkeit nicht stand. Bei aller grundsätzlich möglichen und nötigen Konfessionskritik wird hier doch sehr mit Vorurteilen und plakativen, vorgefassten Klischees jongliert.
Die naturgemäß uniforme Kleidung der Klosterfrauen verdeckt jede Form von Individualität; einzig Angelica, die im Garten arbeitet, lässt Fleisch sehen, hat die Ärmel hochgekrempelt und diese sind noch vom Erdreich bedeckt. Ein Hinweis auf die kräuterbewanderte Nonne, quasi eine neue Hildegard von Bingen, die mit ihrem Wissen auch um Giftiges in der Flora den Grundstein für die spätere Selbsttötung legt. Dass sie sich auf dem Zenit der Handlung des Habits entledigt, soll wohl Emanzipation vom klösterlichen Leben darstellen. Dieser „Striptease“ wirkt hier allerdings völlig deplatziert und platt und korrespondiert nicht mit der anrührenden und mystifizierenden Musik.
Auch die Lichtregie, die in den beiden Rahmenwerken die Inszenierungen traumhaft stützt, ist in Suor Angelica nicht spürbar, erlebbar, einsichtig; abgesehen von wenigen goldenen Lichteffekten zu Beginn und vom Finale mit Übergang ins Transzendente. Diese zwei Momente, wo sich die Klostermauern öffnen (für den Eintritt der Fürstin aus der Außenwelt des Klosters und den Übergang der Angelica ins Jenseits) gehören zu den wenigen Aha-Momenten, welche die monotone Struktur dieser Regiearbeit aufbrechen.
Davon unbenommen sind die sängerischen Leistungen von der Bühne, allen voran die Angelica und die Fürstin, sowie von jenseits der Bühne die des Chores (Opernchor, Kinderchor). Sie tragen über die inszenatorische Langeweile hinweg und retten diesen Teil des Abends.
Mein Tipp: Augen schließen und der traumhaften Musik ergriffen lauschen. Oft sind ja innere Bilder durchaus tragfähig!

Il Tabarro
Das den Abend eröffnende Werk ist die inszenatorische Überraschung dieser Premiere. Der noch jungen Regisseurin Mathilda Kochan gelingt eine Deutung wie aus einem Guss. Dazu kommt eine stilisierte Bühne, die trotz weniger Bauten (ein angedeuteter Bug eines Ladekans mit begehbarem Bauch des Schiffes sowie einer Landungsbrücke) sofort und unmittelbar gefangen nimmt. Ergänzend eine der großen historischen Seine-Brücken, die mit Abendrot beginnend sich bis in die mitternächtliche Mordszene kontinuierlich verändert. Hinter der Opera-Projektion ist eine weitere Hochbühne verortet, die den kleineren und entfernter agierenden Rollen durch Gegenblendungen zusätzliche Spielräume ermöglicht.
Das alles ist nicht affirmativ oder plakativ in Szene gesetzt. Vielmehr sind es die zarten Übergänge, die subtil gestalteten Auftritte, die das Geschehen dem schier unaufhaltsamen Mord am Ende zusteuern. Da greift ein Handlungsrad ins andere. Alles in diesem Verismo-Drama wirkt im Wortsinn der Gattung wahrhaftig, echt und wie aus dem Moment entwickelt; eben glaubwürdig. Wir erleben hautnah die Eifersuchtserzählung um den Eigner Michele und seine Frau Giorgetta, die nach dem Verlust des gemeinsamen Kindes auch ihrer Liebe verlustig gegangen sind, sodass sich Giorgetta dem Arbeiter Luigi zuwendet. „Unser Leben ist voller Plagen, Schmerz und Schweiß…“
Die Welt um sie herum weiß von kleinen und großen Liebeleien zu berichten, drängt sich schmerzhaft dem gescheiterten Paar auf. Liebespaare, Liederverkäufer und Paare aus ihrem Umfeld vertiefen diese Gewissheit des Verlusts der Liebe (Michele) und der Flucht aus der Allianz (Giorgetta). Man leidet mit allen Beteiligten dieser Dreiecksgeschichte gleichermaßen. Ein Leben im falschen Leben.
Luigi fasst seinen Fluchtpunkt und damit sein eigenes Schicksal trefflich in Worte: „Ich möchte zum Messer greifen, um dir aus Micheles Blut einen Diamanten zu pressen!“
Die Tötung des Rivalen Luigi, der nur durch unbedachten Zufall zu früh zum Rendezvous erscheint, scheint angesichts dieser Handlungsmelange zwangsläufig. Der Mantel Micheles, nach dem die Oper benannt ist, verbirgt nur unzureichend das Mordopfer. Die gerade zur Versöhnung erscheinende Giorgetta muss mit Schrecken feststellen, was sich an Bord ereignete. Mit einem Schrei, dem ein Aufschrei im Orchester folgt, endet diese nachdrückliche und beeindruckende Inszenierung.
Heute hätte man das Paar in eine Ehetherapie geschickt. Aber die Psychotherapie war zu Puccinis Zeit noch in den Kinderschuhen (siehe auch mein Artikel zu Korngolds Tote Stadt).
Getragen wird Il tabarro vor allem durch die drei Hauptrollen Ann-Beth Solvang, Leonardo Lee und Jason Kim, die mit kolossaler Leidenschaft und stimmlicher Opulenz die Ideen der Regisseurin umsetzen. Aber auch in der zweiten Reihe bestechen einige Sängerakteure, so u.a. Marija Jokovic als Frugola.
Bericht von der Bühne
Jede der drei Kurzopern hat eine bedeutsame, mithin prägende Kern-Arie im dramaturgischen Verlauf: „Niente! Silenzio!“ von Michele im Tabarro, „Senza Mamma“ in Suor Angelica und das unverwüstliche Opernkonzertjuwel „O, mio babbino caro“ aus Gianni Schicchi.
Sie bleiben auch in der Oldenburger Darstellung als die von besonderer Dramatik, Schmerz und Trauer gezeichneten Momente im Gedächtnis. Momente, in denen die Handlung retardiert. Allerdings eben (leider!) nicht in Suor Angelica, wo der Klosterfrau-Marathon ungerührt um sie herum weiterzieht und damit das einzigartige ariose Werk optisch ziemlich schreddert. Laurettas Arie indes wird durch einen Freeze des Ensembles aufgewertet, Micheles niederschmetternde Seelenschau findet gar auf entleerter Bühne statt.
Alle drei Sängerdarsteller können diese drei besonderen Augenblicke für sich nutzen und Punktgewinne einfahren, die den drei innehaltenden Momenten enorme Strahlkraft und empathische Tiefe verleihen. Bravi!

An der Seine
Im Tabarro setzt das Quartett aus Leonardo Lee als Ehemann Michele, Jason Kim als Rivale Luigi, Ann-Beth Solvang als Giorgetta und Marija Jokovic als Frugola die sängerischen Akzente.
Ann-Beth Solvangs Darstellung der Giorgetta mit ihrer inneren Zerrissenheit zwischen Ehe und Liebschaft, zwischen familiärer Sehnsucht und imaginären Fluchtpunkten mit dem Geliebten, zwischen Genuss des Augenblicks und ehelicher Kontroverse ist nahezu exemplarisch und in ihrer Wandlungsfähigkeit innerhalb von kürzesten Momenten Ausdruck von Verschmelzen mit der Rolle. Dass Solvangs stimmliche Disposition überdies der Dramatik und der Zartheit der Partie gleichermaßen gewachsen ist, macht ihre Leistung zu einem Erlebnis. Ihr warmer Mezzo kann sich zu sicherer und voluminöser Höhe aufschwingen, die nie ins Metallische abgleitet.
Jason Kim, lange Jahre als Ensemblemitglied am Haus, kehrt als Luigi ans Staatstheater zurück. Sein Tenor ist von edlem, gut kontrolliertem und warmem Charme, den er mit Nonchalance und Souveränität einzusetzen weiß; im Parlando mit guter Kenntnis der italienischen Schwerpunkte, im Aufbäumen mit sicherem Stand eines erfahrenen Sängers, der seine Kräfte gut einzuteilen weiß. Wer weiß, wohin Kim sein modulationsfähiger und klangprächtiger Tenor noch führen wird? Gestalterisch ist er, trotz reiferer Jahre, ein natürlich und jugendlich wirkender Liebhaber, der mit wenig Mitteln die Bühne für sich nutzen kann. Die Umarmungen und Kuss-Szenen wirken echt und einnehmend, als erlebe man hier ein wirkliches Liebespaar. Verismo pur!
Leonardo Lee als gehörnter Ehemann Michele und als tief leidender Mensch, dem seine Lebenspläne und Hoffnungen zusehends abhandengekommen sind, ist eine Erscheinung für sich. Der stückprägende Mantel umgibt ihn wie einen Panzer. Seine tief erschütternde Arie „Niente! Silenzia!“ ist ein Fanal für seine Gebrochenheit, die zwischen Wut und Ergebung mäandert. Seine durchaus auch warme Stimme wird im Tabarro vor allem dramatisch gefordert. Dann kann Lee sich nahezu mühelos gegen das üppig aufspielende Orchester durchsetzen. Augenblicke tiefster Verzweiflung, die man ihm unbedingt abnimmt, die man gerne zu teilen bereit ist. Auch im sotto voce solistisch und mit Giorgetta ist sein Organ von vielen Zwischentönen beseelt, die einzunehmen weiß; eingeschlossen die finale Mordszene.
Marija Jokovic, die äußerst knapp die nicht ganz leichte Partie der Frugola übernommen hatte, kann mit glänzender Darstellung (eine der wenigen poppig-farbigen Gestalten im Set) und stimmlicher Opulenz für sich einnehmen. Das Gespräch mit Giorgetta um die Frage des optimalen Wohnortes, um Familie und Ehe ins sichere Fahrwasser zu führen (Stadt-Land-Konflikt), sowie neckische Einlassungen zu ihren Haustieren sind wenige, etwas heitere Töne im ansonsten eher kargen, prekären und depressiven Milieu. Da plaudern, ganz dem Verismo-Ideal zugetan, zwei Frauen über das Leben, das Leid, den Alltag. Dass Jokovic ihre Ariosi und deren instrumentalen Nachspiele gar mimisch und gestisch „choreographiert“, unterstreicht ihr komödiantisches Talent.
Gabe Clarke als sicherer und postpubertärer Jüngling Il Tinka ist ebenso hörens- und sehenswert wie Joao Fernandes als Il Talpa und Mark Serdiuk (sehr aus der Ferne, aber tragfähig) als Liederverkäufer. Übrigens höchst amüsant und mit ironischer Brechung, dass Puccini hier eines seiner populärsten Werke als Schlager veräußern lässt: „Mi chiamano Mimi“ aus seiner Bohème ertönt mehrfach in Orchester und Stimmen…
Im Kloster
In Suor Angelica ist das gesamte zehnköpfige Ensemble der Klosterfrauen auf die Protagonistin zugeschnitten. Malgorzata Pawlowska als Gast für die Angelica ist eine Sängerdarstellerin nach Maß, die sich aus den Versenkungen des Leids zu Beginn im Verlaufe der Oper aufschwingt zur zutiefst verletzten, zutiefst vereinsamten Nonne Suor Angelica. Im Dialog mit der Fürstin weiß sie sich erstmals mit stimmlicher Kraft und mit verhaltener Opposition zur Wehr zu setzen. Indes, vergeblich ist der Versuch des sich Aufbäumens. Als sie erfährt, dass ihr Kind im Alter von 5 Jahren verstarb, ohne dass sie es auch nur noch einmal sehen konnte, bricht ihr Widerstand, ihre Kraft, ihr Wille zum Überleben in der klösterlichen Gemeinschaft. Ihre zentrale Arie Senza Mamma, die bei Pawlowska zwischen Vision und Wirklichkeit oszilliert, ist ein Höhepunkt der Partitur. Traumhaft! Albtraumhaft!
Melanie Lang als grausame, unempathische Fürstin ist der einzige Widerpart, Reibungspunkt in einer ansonsten eher handlungsarmen Story. Ihr satter Alt kann der Bedrohlichkeit der Partie zu nachdrücklicher Spannung verhelfen. Die Gnadenlosigkeit ihrer Intention, eine Unterschrift zur Aufgabe des Angelica zustehenden Erbteils abzupressen, um dann unmittelbar die Szene zu verlassen, kann Lang stimmlich mit kühler Distanz und mit energischem Feuer gleichermaßen unterstreichen. So einer Person möchte man im wirklichen Leben nicht begegnen!
Die Vielzahl an weiteren kleinen und kleinsten Rollen aus der ausnahmslos weiblichen Sängerschaft besticht durch Präsenz und Präzision. Im Ensemble vermeint man, tatsächlich ein Klosterkonvent zu spüren: Absolut sauber im Klang und äußerst homogen. Gregorianik in der Oper!
Eine besondere, wenn auch nicht sichtbare Leistung vollbringen Kinderchor (Antonio Gallego) sowie Opern- und Extrachor (Thomas Bönisch) aus dem Off. Das Finale, das Angelica nach dem selbst gemixten Gifttrank dem Jenseits zuführt, ist eine sängerische Glanzleistung der Chöre und tatsächlich eine Himmelsleiter, auf der Angelica diese Welt in eine möglicherweise bessere, menschlichere, zugewandtere verlassen kann und darf.
An Arnos Fluten in Florenz
Gianni Schicchi als Wiederaufnahme mit erheblich verändertem Ensemble ist natürlich der szenische Fluchtpunkt des Abends. Er ist gewissermaßen die „Entschuldigung“ Puccinis für wackeres Durchleben der beiden ersten Dramen, die einen als Zuschauer doch emotional mächtig fordern. Da ist die Geschichte um den reichen Donati mit großer, vielseitiger Erbschaft, um die nicht weniger als acht Erben trefflich streiten, doch ein munterer Kehraus. Wobei vor der durchaus heterogenen Familientruppe noch allerhand Fußangeln liegen, die man mit Hilfe des gerissenen Schicchi aus dem Weg räumen möchte. Dazu die bereits beschriebene Liaison der beiden jungen Liebenden Lauretta und Rinuccio, um deren Zukunft man als Zuschauer ebenfalls bangt.
Donato di Stefanos Darstellung des Schicchi muss unbedingt einnehmen. Im Gegensatz zur akkurat gekleideten Familiensippe ist er mit Hosenträgern und Feinripp die Provokation himself. Er poltert, er bestimmt, er säuselt und kreischt, je nachdem wie es die Szene erfordert. Seine Stimmgewalt ist enorm, auch wenn er bisweilen leicht zum Chargieren neigt, was natürlich der Rolle eher zuträglich ist. Die Darstellung des Donati-Doubles im Bett mit ersterbendem Stimmvermögen ist eine Klasse für sich. Und neben dem eigenen finanziellen Mehrwert hat er vor allem auch das Glück der Liebenden im Blick.
Oft vergessen wird auch, dass Schicchi nicht wirklich alles sich selbst im Testament zuschreibt: Jeder aus der geizigen Verwandtschaft erhält tatsächlich zunächst sein gewünschtes Landgut, bevor sich der Schlauberger Schicchi den Maulesel, die Mühle, die Villa und den Rest zuschreibt, um danach die ganze Mischpoke aus dem Haus zu jagen. Di Stefanos körperlicher Einsatz bei all diesen Aktionen ist bewundernswert. Vor allem auch, dass ihm bei all diesen turbulent inszenierten Verfolgungsjagden und halsbrecherischen Augenblicken die Stimme, die Koordination mit dem Graben und die Genauigkeit nicht abhandenkommt. Er benötigt offensichtlich zu keinem Zeitpunkt einen Monitor; eher flirtet er gekonnt mit dem Publikum.
Paola Leoci als Lauretta ist eine gewinnende Persönlichkeit, welche die Rolle mit Charme und Unschuldsmiene spielt, brav dem „Babbino“ ergeben und hingebungsvoll dem Liebsten zugetan. Ihre hohe und klare Sopranstimme ist ideal für die einzige Arie „O, mio babbino caro“. Offen bleibt, ob sie sich hier wirklich in den Arno stürzen will oder ob sie Schicchi nur neckisch foppt. Sie ist mit Papa zusammen ein Team, das so exakt der Commedi dell`arte entsprungen sein könnte. Von Leoci möchte man unbedingt etwas von Mozart, Bellini oder ein Ännchen hören!
Die überraschend schöne Tenorstimme des Gastes Beomjin Kim als Rinuccio ist von kolossaler Energie, wie man sie vielleicht nur als junger Tenor haben kann. Indes, er schreit nie, fordert seine Belcanto-Stimme nur in sehr wenigen Momenten, etwa wenn er von Florenz schwärmt. Puccini fließt bei ihm klar und tragfähig, seine jugendliche Art ist nachgerade ideal für die Darstellung des Rinuccio. An der Seite von Leoci ein sängerisches Traumpaar, dass man sich auch als Rodolfo und Mimi vorstellen könnte.
Die übrige Sippschaft ist ein Ohrenschmaus und eine Augenweide. Aus ihr möchte man kaum jemanden hervorheben. Das Ensemble ist sängerisch, gestalterisch und choreographisch (!) der Star des Abends. Eine der treibenden Kräfte gegen alle Grundsätze, die gegen Schicchi als Retter des Erbes sprechen, ist die Zita von Melanie Lang, deren komödiantisches Talent einmal mehr hier zündet. Fast glaubt man nicht, dass sie am gleichen Abend kurz zuvor bereits die gnadenlose Fürstin in Angelica gab.
Johannes Leander Maas als Gherardo und Martha Eason als hochschwangere Nella, Stephen Foster als aristokratischer Betto von Signa, Paul Brady als Marco, Joao Fernandes als Simone, Marie-Sophie Janke als Ciesca; sie alle sind als Team unschlagbar. Und die wunderbare Regie von Tobias Ribitzki hat ihnen, die allesamt Abziehbilder wirklicher Personen sind, herrliche szenische Einfälle auf den Leib geschrieben: Nella am Lüster hängend, Simone als greiser Ex-Bürgermeister im Rollstuhl, den er allzu häufig verlässt, der stets an seiner Kleidung nestelnde Gherardo, der Grimassen schneidende Marco, die zickige Ciesca und der mit gespielter Zurückhaltung sich selbst in Szene setzende Betto. Ein Fest für die Augen und die Ohren, denen sich als Karikaturen noch Ryan Stoll als Notar und Seung Jin Park als Arzt hinzugesellen.
Ein kleines Haus wie Oldenburg hat neben den eigenen Kräften offensichtlich zahlreiche Netzwerke, die einen so opulent besetzten Abend ermöglichen. Chapeau!
Nachrichten aus dem Graben
Die farbenfrohen, aber im Einzelnen durchaus unterschiedlich gewichtenden Partituren liegen bei GMD Hendrik Vestmann in den besten Händen. Puccini schwelgt, seufzt, klagt, betört, erklingt mal mit Wucht mal mit erlesener Zartheit. Das Oldenburgische Staatsorchester genießt die Farbenspiele Giacomos und breitet tragische, melancholische und burleske Szenen mit gekonntem Pinselstrich aus. Rubati, Fermaten, colla voce passen sich dem Bühnengeschehen in Tempo und Dynamik bestens an.
Zur Habenseite gehören absolut die Stimmungsbilder am Seineufer, das mystische Finale in Angelica und die Massenaufläufe in Schicchi, die (höchst komplex daherkommend) akkurat aus dem Graben erklingen. Herrlich die verstimmten Drehorgelklänge im Tabarro, die wenige Jahre später sich ähnlich in Strawinskys Petruschka wiederfinden. Zahlreiche illustrierende, außermusikalische Assoziationen befördernde Holzbläsersoli in Angelica.
Puccinis selbstzweiflerische Gedanken, wie weit er sich über die Tonalität hinauswagen könnte und mit welchen klangfarblichen Mitteln er das Spektrum erweitern sollte, finden in außergewöhnlichen Farbkombinationen (Streicher, Pauke) und in mannigfaltigen Spielarten bei den Streichern Berücksichtigung (weite Passagen mit ponticello-Flächen, col legno Episoden, die fast an Schlagwerk erinnern, u.v.m.). Im Tabarro tuschiert Puccini die Grenzen zur Tonalität, ohne sie zu überschreiten; mit Bitonalität und scharfen Sekundreibungen zur Schilderung der Seelenklagen.
Hier spürt man ein wenig den Respekt gegenüber dem zeitgleich agierenden Arnold Schönberg, den er bewunderte, aber nicht verstand. Dessen Pierrot lunaire besuchte er bei der Uraufführung in Florenz im Jahr 1924. Der schon schwer erkrankte Puccini hörte das visionäre Opus Schönbergs, ohne es durchdringen zu können. Sechs Stunden Fahrt nahm er auf sich, um einen Blick in die musikalische Zukunft zu wagen. „Sehr schön. Interessant!“ soll er Schönberg gesagt haben nach der Aufführung, bei der er die Partitur auf dem Schoß mitgelesen hatte. Und später ergänzte er: „Wer sagt uns, dass Schönberg nicht ein Ausgangspunkt für ein ferneres, zukünftigeres Ziel ist?“ Wie wahr!
Bei aller emotionalen Beteiligung und dem Ausloten der Partitur in seine Vielzahl an Stimmungen, Farben und thematischen Verästelungen muss man leider erneut konstatieren, dass die dynamischen Eruptionen (vornehmlich im Tabarro) bisweilen Überhand nehmen, sodass selbst stimmlich optimal ausgestattete Sänger(paarungen) wie Solvang, Kim und Lee immer wieder übertönt werden; und das, obgleich sie an der Rampe stehen.
Diese Unart, die manch schönen Klimax beschädigt, setzte sich leider auch in Angelica fort, wo selbst ohne Blech und Schlagwerk zarte Passagen ohne Not zugedeckt werden. Hier allerdings verortet die Regie die Protagonisten auch deutlich zu weit im Bühnenhintergrund, wo das Oldenburger Haus alles andere als akustisch optimal ist. Da gälte es eventuell nachzujustieren, um den glanzvollen Gesamteindruck noch zu unterstreichen.
Fazit
Die finale Produktion der Opernsparte in der Ära Firmbach lässt es nochmals ordentlich krachen mit einem Feuerwerk an Stimmen und Stimmungen. Eine ebenfalls atmosphärisch dichte Orchesterleistung lässt im Verein mit einem guten Zusammenspiel aller Gewerke den Oldenburger Trittico fulminant erstrahlen.
Das aufmerksame Premierenpublikum spendete reichlich Beifall, teilweise enthusiastisch mit Bravi durchsetzt. Im Schlussbild erscheint vor dem Blackout der Intendant selbst, der einen großen Karton in Händen hält: Schreibtisch und Büro wurden schon verpackt. Die Abreise nach Karlsruhe steht ins Haus. Fortune!
Oder wie es am Ende des Trittico Gianni Schicchi ans Publikum gewandt formuliert: „Aber mit Erlaubnis von Väterchen Dante: wenn ihr euch heute Abend amüsiert habt, gewährt mir mildernde Umstände!?“ Sehr gerne!
p.s.:
Die im Titel dieses Essays erwähnten Luftballons geisterten schon in der Bewerbung des Oldenburger Trittico durchs Netz und finden jetzt, von Kindern über die Bühne getragen, auch Eingang in die Szenen der drei Kurzopern. Damit wird vermutlich eine minimale Verknüpfung der drei Kurzwerke angestrebt?
Alle drei Ausstattungen sind von historisierender Grundbestimmung, in denen der rote Kunststoff der Ballons deplatziert wirkt. Am ehesten passt er noch ins überaus bunte Ambiente des Schicchi, kaum aber ins düstere Seine-Ambiente des Tabarro und gänzlich daneben ist er in der finalen Erlösungsszene der Angelica. Warum solche Regie-Mätzchen? Dieser Oldenburger Trittico hat das beileibe nicht nötig!

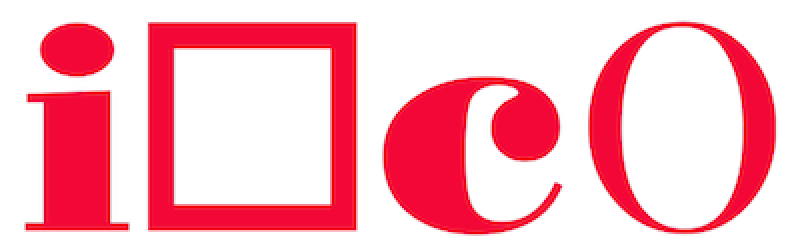

Kommentare ()