Gießen, Stadttheater, GMD Michael Hofstetter im Interview, IOCO, 23.11.2017



GMD Michael Hofstetter im Interview
"Das tiefgründige an der Oberfläche verstecken"
Ljerka Oreskovic Herrmann (LOH) führte für IOCO das folgende Interview mit Michael Hofstetter, *1961, seit 2012 Generalmusikdirektor am Stadttheater Gießen.
LOH: Ist die Operette eine veraltete, altmodische Theaterform?

MH: Gar nicht. Ich finde man kann grundsätzlich jedes Theater altmodisch oder altbacken inszenieren. Oder man kann es sehr lebendig inszenieren. Ich glaube es ist eine Frage der Umsetzung. Und da ist in unserem Fall, die Arbeit von Balász Kovalik (Regisseur von Herbstmanöver) sicher ein unglaublich berührendes Meisterwerk geworden. Grundsätzlich, finde ich die Operette überhaupt nicht altmodisch. In moderner Form lebt sie sowieso weiter, sagen wir als Soap-Opera – nur ist sie im Original viel besser.
LOH: Liegt es vielleicht daran, dass man die Operette als „harmlos“ betrachtet, was sie ganz und gar nicht ist?
MH: Absolut. Es trifft genau ins Schwarze und hätte ich nicht besser sagen können. Man denkt, es ist harmlos, schöne Melodiechen, derweil steckt so vieles da drin, auch an ehrlicher Emotion, ein großes Stück Zeitgeschichte, wirklich ein Gesellschaftsspiegel.
LOH: Vielleicht weil man lacht, denkt man: „Es ist nicht so schlimm.“ Bei der Fledermaus hat man die Parodie und den Fasching, wo alles verhandelt wird – die ganz tiefen Emotionen.

MH: Ja. Ich denke dabei gleich an ein Zitat von Hugo von Hofmannsthal, der mal in einem Interview gesagt hat, er müsse das Tiefgründige verstecken. Dann fragt der Interviewer, aber wo: ‚An der Oberfläche, natürlich!’
LOH: Das sind wir wieder bei der Operette. Was macht für Sie das Faszinosum „Operette“ aus?
MH: Ich war zunächst Kirchenmusikstudent, und ich bekam in München eine Stelle an einem Tourneetheater als Studienleiter. Ich dachte, etwas nachdirigieren während meines Studiums wäre toll, es war ‚learnig by doing’, was wirklich unbezahlbar ist. Und natürlich war das Repertoire dieses kleinen Tourneetheaters im Landkreis München primär die Operette, zu 70-80%. Und so fing ich aus Neugierde an, auch um mein Kirchenmusikstudium dirigentisch zu unterfüttern. Ich verliebte mich aber dann in das Theater und wechselte wirklich von einem Tag auf den anderen, während meines Studiums, von Bach, Messiaen und Max Reger zu Johann Strauß, Kálmán und Max Greger, und ich landete so weich. Es ist keine intellektuelle Antwort, es ist eine Gefühlsantwort. Ich fühlte mich zuhause. Das gilt auch für die Kirchenmusik, aber die Begegnung mit der Operette war auf unerwartete Weise glücklich.
LOH: Aber ist denn das, was in einer Kirche stattfindet, nicht auch „in gewisser Weise“ Theater?! Und wenn wir wieder auf die Operette zurückkommen: Was macht eine gute Operette sowohl musikalisch als auch inhaltlich aus? Sind es die für die Wiener Operette geltenden „Dreiklänge“: Walzer-, Polka- und Marschmusik?
MH: Das stimmt wahrscheinlich, dass es von der Kirche zum Theater überhaupt nicht so weit ist. Das Tolle an der Operettenmusik ist, dass diese aufgeschriebene, notennotierte Musik sich nährt aus Musik, die nicht minutiös aufgeschrieben wurde. Das eine sind die Wiener Walzer, und die wurden in Wien sicherlich erst mündlich tradiert, durch die Strauß-Kapellen oder Tanzkapellen. Es waren Haydn, Schubert, die Ländler und Trios aufgeschrieben, aber nicht genuin erfunden haben; vieles kommt direkt aus dem Einflussbereich der alpenländlichen/volkstümlichen Musik. Auch das ungarische Element – Csárdás, Zigeunerkapellen – ist sicherlich keine Musik, die in ihren Ursprüngen genauestens notiert wurde, sondern vom Meister zum Schüler, von einem Musiker zum anderen Musiker durch das gemeinsame Musizieren weitergegeben wurde. Diese genialen Operettenkomponisten – wie Lehár, Kálmán oder Johann Strauß – schreiben es dann auf für ihre Kapellen. In dieser zweiten Generation, bei Lehár und Kálmán, kombinieren sie das Ganze mit der großen Blechbläserbesetzung des sinfonischen Orchesters sowie mit einem damals schon vom frühen Jazz angehauchten Schlagwerk. D.h. sie begründen und bereiten etwas vor, was später zum Big Band-Sound wird, und lassen mit diesem witzigen und raffiniert eingesetzten Schlagzeug und mit den raffiniert komponierten Bläsersynkopen das schwere Blech tanzen. Auch die frühe Filmmusik wäre ohne sie gar nicht denkbar.
LOH: Und inhaltlich?
MH: Da können wir gleich auf unser Stück kommen – auf Herbstmanöver. Das ist inhaltlich so grandios, schön, so einzigartig. Es gibt Szenen, die an Strindberg oder Szenen und Atmosphären, die an Tschechows Kirschgarten erinnern. Da gibt es Figuren, wie den alten Diener, da denkt man an den Firs aus dem Kirschgarten, der Jahrzehnte auf seine Herrschaft wartet, die irgendwo in der Stadt ist. Das Stück ist reich an tiefen Situationen und Emotionen Es findet sich aber auch brillantester jüdischer Humor, total spritzig, witzig, raffiniert, süffisant. Eine historische Aufnahme von 1908, auf der der Burgschauspieler Max Pallenberg eines der Couplets aus dem Herbstmanöver singt, lässt uns den virtuosen Esprit dieses Genres erahnen. Das ist von jüdischen Autoren für ein Publikum, dass das verstanden hat, geschrieben. Für so viel Selbstironie braucht es wahre Geistesgröße. Und dann die Liebesgeschichten, die verhandelt werden, die haben große Tiefe. Die Beziehung zwischen Riza und Lörenthy erinnert an Eugen Onegin. Der Unterschied ist nur, wenn die Musik hinzukommt, dann ist es in der Operette immer eine Musik, die so einen Tanzrhythmus hat – Walzer, Polka oder Marschryhthmen, bei Herbstmanöver viel Valse lento, weil das eben eine elegische Geschichte ist.

LOH: Was macht die Besonderheit von Kálmáns Ein Herbstmanöver aus? Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
MH: Wir haben verschiedene Operetten geprüft, wobei ich noch einmal Balász Kovalik erwähnen möchte, der Unbezahlbares für unser Haus geleistet hat. Wir wollten ein unbekanntes Stück machen und uns nicht aus dem Kanon, der immer wieder gespielten Operetten, bedienen. Diese ganze Recherche unternahm Balász. Er fuhr nach Budapest in die Archive, immer wieder. Balász und mir war dann sehr schnell klar, dass wir mit der Operette Herbstmanöver, die meines Wissens achtzig Jahre nicht gespielt wurde, einen Schatz bergen können. So einen Fund wie diesen, macht man vielleicht ein Mal alle zehn Jahre, und bei den Proben hat sich das mehr und mehr bewahrheitet.
LOH: Warum verschwand dann diese Operette aus dem Repertoire? Kálmán war, auch wenn er es nicht zunächst nicht glauben wollte, mit dem Stück durchaus erfolgreich?!
MH: Super erfolgreich. Hunderte Male en Suite in Budapest, in Wien und in Berlin, wobei es in den jeweiligen Städten leicht unterschiedliche Fassungen gab. Wir haben in unsere Aufführung auch Musik aus der nicht gedruckten Budapester Uraufführung genommen – ein Duett von unfassbarer Schönheit für die beiden Hauptpartien Lörenthy und Riza komponiert. Alleine dieses Duett zu hören, lohnt bereits den Besuch der Vorstellung.
Warum das Stück aber, nachdem es ein Erfolg war, nicht mehr gespielt wurde, kann ich nur erahnen. Ein Erklärungsansatz könnte sein, dass diese Tartaren- und Husarengeschichte nach dem 1. Weltkrieg, als die Tartaren ins Giftgas geritten und umgekommen sind, nicht mehr gespielt werden konnte. Im ungarischen Original heißt das Stück Tatárjárás – ‚Tatarenplage’, weil die Tataren angeblich weniger ans Kämpfen dachten, sondern lieber ans Tanzen und an Frauen. Sie ziehen die feschen Uniformen an, weil sie damit bei den Frauen gut ankommen. Kálmán hat danach weiter komponiert und u.a. mit der Csárdásfürstin und der Gräfin Mariza sein geniales Erstlingswerk in gewisser Weise in den Schatten gestellt hat.
LOH: Ist nicht gerade die sogenannte „leichte Muse“ eine besonders schwere Angelegenheit?
MH: Die Operette braucht das Witzige. Und das soll jetzt kein Widerspruch zu dem sein, was ich vorher sagte, dieser Sprung von der Kirchenmusik zur leichten Muse und auch meine Erfahrung am Wiesbadener Theater, wo ich meine ersten Jahre nach dem Studium als Kapellmeister verbracht habe, ist: Dass es leichter sein kann, sich Tragödien und all diesen großen Themen zu nähern, als der leichten Muse. Verdi war, zumindest für mich, lange Zeit zugänglicher als Rossini. Es braucht vielleicht Lebenserfahrung, damit man das Augenzwinkernde verstehen kann, und das ehrliche, wahrhaftige menschliche Gefühl mit dem Leichtfüßigen und dem Esprit verbinden kann. Wenn das gelingt, ist das ganz besonders beglückend.
LOH: Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Sind Sie mit dem Linzer Operettenkomponisten Igo Hofstetter verwandt?
MH: Leider nicht, wäre schön. Es ist eine typische Musik der 50er Jahre, schöne Musik, aber ganz fein gemacht. Und er ist der geistige Erbe von Kálmán. Seine Musik ist sehr bläserlastig, dazu ein beschwingtes Schlagzeug, und schon fängt das Blech an zu tanzen. Eine ganz wunderbare Musik. Aber – meine Vorfahren kommen vom Chiemsee – wir sind zu meinem großen Bedauern weder verwandt noch verschwägert. Schade.
LOH: Herr Hofstetter, ich danke Ihnen für das anregende Gespräch
---| IOCO Interview Stadttheater Giessen |---

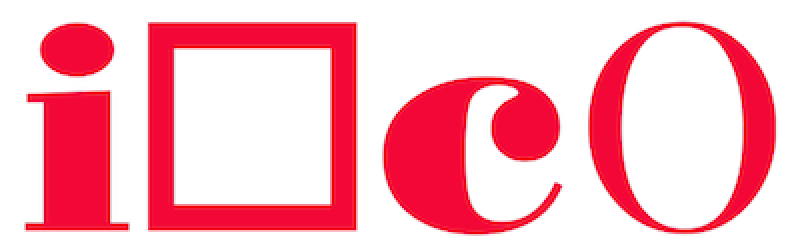

Kommentare ()