München, Bayerische Staatsoper, KRIEG UND FRIEDEN - Sergej S. Prokofjew, IOCO Kritik, 07.03.2023



KRIEG UND FRIEDEN - Oper von Sergej S. Prokofjew
Komponist und Libretto Sergej S. Prokofjew; nach Lew N. Tolstoi - Koproduktion mit Gran Teatre del Liceu
- Man sollte Tolstoi gründlich gelesen haben -
von Hans-Günter Melchior
Im Grund genommen kann man so ein Werk nur richtig und zugleich falsch machen, halb richtig und halb falsch. Hinzu kommt, dass man Lew Tolstoi, 1828-1910, gelesen bzw. wieder einmal gelesen haben sollte, zumindest in den wesentlichen Passagen und zwar auch angesichts der Tatsache, dass das Libretto nicht mit dem Text des gleichnamigen Buches von Tolstoi deckungsgleich ist.
Dmitri Tcherniakov hat die in jeder Hinsicht Aufsehen erregende Aufführung inszeniert und auch das Bühnenbild geschaffen. Eine Herkulesaufgabe, die zuweilen zu einer Art Wimmelbild gedieh, streckenweise auch etwas missriet. Missriet deshalb, weil die exemplarische Vielzahl an Personen auf der Bühne die Übersicht erschwerte, so dass man manchmal richtig suchen musste, wo gerade die Handlung sich abspielte, am linken oder rechten Bühnenrand oder weiter hinten und dergleichen.
Schon Prokofjew, 1891-1953, der maßgebend das Libretto entwickelte, hatte es offenbar schwer, der Stofffülle zu gebieten, vor allem aber politisch-ideologisch den richtigen Ton zu finden. Die stalinistische Gewaltdiktatur machte Vorschriften, setzte Grenzen, gebot Ideologisches.
KRIEG UND FRIEDEN - Vladimir Jurowski und Dmitri Tcherniakov im Gesprächyoutube Bayerische Staatsoper[ Mit erweitertem Datenschutz eingebettet ]
Musikalisch wie textlich. Gefordert im zweiten Teil war inhaltlich die patriotische Verherrlichung des russischen Volkes als Träger der revolutionären Idee. Verlangt war die vaterländische Feier des russischen Volkes, das sich heldenhaft gegen einen Aggressor behauptete. Und zwar in doppelter Hinsicht: von Napoleon und Hitler.
Musikalisch war Prokofjew – wie Schostakowitsch – dem berühmt-berüchtigten Vorwurf des Formalismus ausgesetzt. Worunter die stalinistische Doktrin die Moderne im Allgemeinen und im Besonderen deren Trend zu den formalen Aspekten eines Werkes wie etwa die Dominanz der Konstruktion unter Hintanstellung der inhaltlichen Aspekte verstand. Rein künstlerisch kam der Formalismusvorwurf einem Todesurteil gleich.
Prokofjew hielt sich in Krieg und Frieden im Wesentlichen an die „Vorschriften“. Unter Zwang.
Andererseits auch wieder nicht. Denn die Musik enthält trotz allem Kühnheiten, vor der die Parteibonzen offenbar resignierten. Sie ist zwar an die Tonalität gebunden, enthält jedoch für den an den traditionellen Wohlklang gewöhnten Hörer manche sehr ungewöhnlichen Akkorde und changiert zwischen gelegentlicher Fahlheit und Ausbrüchen emotionaler Enthemmung. Insgesamt ist diese Oper musikalisch betrachtet modern, indem sie den Zweifel an dem Wohllaut der traditionellen Harmonien aufnimmt, zuweilen rau und fast rücksichtslos Emotionen aufwühlt und besonders im zweiten Teil eine Weltuntergangsstimmung erzeugt, wenn vom Kampf und dem Krieg die Rede ist.

Dirigent Vladimir Jurowski hat die mutmaßliche Intention des Komponisten (vielleicht indem Letzterer absichtsvoll, geschickt und scheinbar konzessionsbereit einige Passagen mit traditionellen Einfärbungen versah) geradezu hinreißend umgesetzt. Da fehlte nicht die geringste Nuance, keine Einzelheit entging dem dirigentischen Scharfsinn. Und das Staatsorchester folgte ihm bedingungslos. Die Leistung des Dirigenten und des Orchesters war für den Verfasser dieser Zeilen das eigentliche Erlebnis dieses Abends.
Die Oper hat zwei inhaltlich ziemlich streng voneinander getrennte Teile.
Im ersten Teil, der im Vergleich zum Roman die Erzählung zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt aufgreift, geht es ausschließlich um die persönlichen Beziehungen innerhalb der zaristischen Adelsgesellschaft. Erst am Schluss wird auf den Einfall der französischen Armee hingewiesen.
Im Mittelpunkt steht die Liebesbeziehung zwischen dem Fürsten Andrej Bolkonski und Natascha Rostow. Andrej Bolkonski erklärt seine Liebe zu Natascha, die beiden beabsichtigen zu heiraten.
Andrej ist dann allerdings eine Zeitlang unterwegs. Unterdessen wird Natascha von der Intrigantin Heléne Besuchowa mit dem verheirateten Anatol Kuragin bekannt gemacht, die beiden verlieben sich und beschließen zu fliehen. Der Fluchtplan wird aufgedeckt und vereitelt, Pierre Besuchow, ein Freund Andrejs klärt Natascha dahin auf, dass Kuragin verheiratet ist.

Im zweiten Teil wird das Kriegsgeschehen abgehandelt. Napoleon, der mit seiner Armee in Russland einfiel, tritt als Beobachter der Schlacht auf. Die Franzosen plündern. Pierre, der Napoleon zu töten trachtet, wird gefangen-genommen, entgeht aber der Erschießung. Er freundet sich mit dem einfachen Soldaten Platon Karatajew an. Dieser wird von einem französischen Soldaten erschlagen.
Andrej Bolkonski wird schwer verwundet und wird im Haus Rostow gepflegt. Er stirbt in den Armen der reuemütigen Natascha.
Die geschlagene Armee Napoleons zieht sich schließlich zurück, Pierre wird befreit. Die Russen feiern ihren Sieg.
Selbst in der vom Regisseur verschlankten Fassung wird hier überschwänglicher Patriotismus nicht vermieden. Kein Volk der Erde übertreffe das russische heißt es an einer Stelle. Und das ist noch die harmloseste Behauptung, die Prokofjew anbefohlen wurde.
Tcherniakov lässt beide Teile im nachgebauten Säulensaal des Gewerkschaftshauses, siehe Fotos, in Moskau spielen. Ein Prachtsaal mit Lüstern und Glitzerschmuck, eine historische und architektonische Sehenswürdigkeit.
Es fällt freilich in der konkreten Inszenierung schwer, sich hier einen festlichen Ball aus der Zarenzeit des 19. Jahrhunderts vorzustellen. Die Bühne ist mit Menschen (offenbar Flüchtlingen) derart übervölkert, dass es manchmal schwer fällt, das Zentrum der Handlung auszumachen. Und es findet auch keineswegs ein festlicher Ball mit reichen Garderoben statt, ein Walzer wird einmal getanzt, viel mehr ist da ist. Die Stimmung ist eher geprägt von einer Bereitschaft zur sachlichen Diskussion, der Aufarbeitung des Geschehens, den Sorgen der Menschen. Das arme Volk ist immer anesend, kauert im Hintergrund.
Den Akteuren sieht man auch nicht die adelige Herkunft an. Weder in der Kleidung noch im herrschaftlichen Gehabe noch im Verhältnis der Gesprächspartner zu ihnen. Keine Unterwürfigkeit. Alle Personen tragen eine eher schäbige Straßenkleidung, einige Pullover und Jeans oder nur ein Hemd an –, kurz: eine Verbindung zum Gepränge der Adelsgesellschaft, die die festlichen Veranstaltungen im Roman beherrscht, wird geradezu sorgfältig vermieden. Hier tummelt sich ein Volk, das in die Nähe des Lumpenproletariats gerät. Selbst die Adeligen wirken ärmlich.

Natürlich ist das ein Regieeinfall. Hier wird das Schicksal, ja zuweilen das Drama des Volkes vorgeführt, dem alle gleichermaßen angehören. Keine Adeligen und Großgrundbesitzer ohne Untergebene, ja Leibeigene. Es wird wohl signalisiert: da ist eine Einsicht gewachsen.
Es geht im ersten Teil um die Liebe und die Verführungen, die Enttäuschungen, die Verlogenheiten und die enttäuschten Hoffnungen. Und im zweiten Teil um die grausamen Schicksale und Gemeinheiten, die mit dem an einen Euphemismus grenzenden, fast neutralen Begriff Krieg nur unvollkommen beschrieben sind. Als wäre Krieg nichts weiter als ein taktisches, rational planerisches und politisches Ereignis und nicht ein menschliches Drama, eine Anhäufung von Gemeinheiten und Grausamkeiten.
Zu so einer Konzeption und Einsicht passt natürlich das Gepränge der Festlichkeiten nicht, in denen sich die Adelsgesellschaft der zaristischen Gesellschaft im frühen 19. Jahrhundert gefiel und selbstbespiegelte. Gezeigt werden soll wohl die Reduktion des Menschen auf die wahren Gefühle und Existenznöte.
Andererseits leidet gerade dadurch die Konzeption an einem entscheidenden Mangel: man nimmt ihr den Bezug auf Leo Tolstois großen Roman nicht ab. Tolstoi ging es nicht zuletzt um die Darstellung hohl und inhaltsleer gewordener Rituale angesichts einer Realität des Krieges, die die Menschen auf das Elementare reduziert und gleichmacht. Es fehlt der Inszenierung die unmissverständliche Verdeutlichung der Zeitenwende. Ganz abgesehen davon, dass die im äußeren Auftreten angedeutete Integration der abgehobenen Adelsgesellschaft in die – verelendete – Gesamtgesellschaft nicht glaubwürdig erscheint. Die Großen werden auch Notzeiten weder klein noch gleich.
Auch die Massenszenen überzeugen nicht durchgehend. Besonders dann nicht, wenn die nicht an der Handlung beteiligten Personen wie tote Tiere einfach auf der Bühne liegen bleiben und offenbar später wieder zum Leben erweckt werden. Als wisse man nicht, wohin damit.
Natürlich drängt sich nicht nur ein Vergleich mit dem Überfall der Deutschen im zweiten Weltkrieg, sondern vor allem ein solcher mit dem gegenwärtigen Krieg in der Ukraine auf. Nur dass dieses Mal, man mag die Oper drehen und wenden, wie mal will, die Russen heute die Angreifer und nicht wie 1812 die Angegriffenen sind. Daran lässt sich ungeachtet der der Inszenierung aufgeladenen Assoziationen und Anspielungen auf das immer leidtragende gemeine Volk nichts ändern. Auch dass die – künstlerisch und stimmlich hervorragenden – Hauptpersonen Fürst Andrej Bolkonski, gesungen von Andrei Zhlilikhovsky und Natascha Rostowa, gesungen und verkörpert durch Olga Kulchynska den Beifall des Publikums in Trikots mit den Landesfarben der Ukraine entgegennahmen, kann nicht zur Umkehrung der wahren Verhältnisse beitragen. Und schon gar nicht die Elogen im Libretto auf eine friedfertige und leidensfähige russische Nation verständlich machen, zumindest nicht unter den obwaltenden realen Verhältnissen. Heute leiden die Ukrainer unter den Russen.
Unter der Vielzahl der agierenden Personen seien noch, um dies nicht zu vergessen, die hervorstechenden Gesangsleistungen des Pierre Besuchow, verkörpert von Arsen Soghomonyan und des Grafen Rostow von Mischa Schelomianski hervorgehoben. Nicht unerwähnt darf auch der Chor bleiben.
Letztlich bleibt also bei aller künstlerischen Anerkennung der Leistungen gerade angesichts des manchmal vor Pathos triefenden zweiten Teils doch zumindest inhaltlich-politisch ein schaler Beigeschmack. Da hätte es gutgetan, ein wenig mehr an Stoff zu tilgen. Obwohl der Regisseur bei einer Einführung versicherte, er habe das Pathos aus dem Libretto herausgenommen.
Übrig blieb noch genug, gerade für die Deutschen, die gebrannte Kinder sind. Ein denkwürdiger Abend, weit über die Musik hinaus voller Probleme. Freundlicher Beifall.

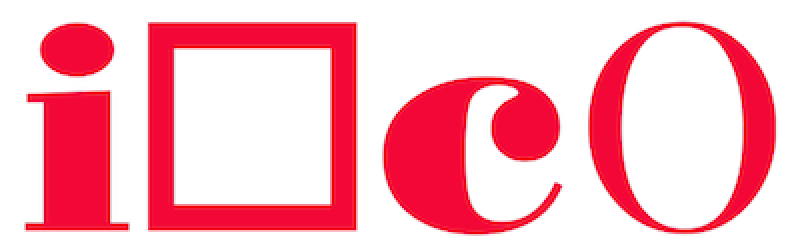

Kommentare ()