Basel, Theater Basel, Elektra - Vom Schaukelpferd zur Schlächterin, IOCO Kritik, 22.01.2018



Elektra von Richard Strauss
"Vom Schaukelpferd zur Schlächterin"
Von Julian Führer
Die Inszenierung von Frank Bösch wurde bereits in Antwerpen und Gent (Vlaamse Opera) sowie in Essen (Aalto-Theater) gezeigt und hatte nun am 12. Januar 2018 auch in Basel Premiere – die vierte Spielstätte für die Deutung eines der zentralen Werke der Opernliteratur des beginnenden 20. Jahrhunderts. Ist diese Version tatsächlich so bedeutend, dass man sie an mehreren Häusern präsentieren sollte?
Der Bühnenraum zeigt zwei große Türflügel, die sich nach hinten öffnen und die aufgetan werden, wenn Klytämnestra und Aegisth die Tore des Palastes von Mykene durchschreiten. Die Wände des Bühnenbilds (Patrick Bannwart, Maria Wolgast) sind schmutzig, vor allem aber blutig. Jemand (sicher Elektra) hat in Riesenlettern „Mama, where is Papa“ geschrieben (Englisch wegen der Premiere in Antwerpen?). Im linken Bühnenbereich sind etliche Grablichter zu sehen, rechts ein Bett: Wir befinden uns bei Elektra. Am und im Bett stehen Kindersachen, unter anderem ein Schaukelpferd.
Elektra ist hier jung, sogar sehr jung, pubertär. Die einzigen Männer, die sie kennt, sind ihr ermordeter Vater und ihr Bruder, der nicht heimkehrt. Emotional ist sie einerseits verkümmert, andererseits brodelt es in ihr. Ihre maßlose Aggression wendet sie gegen ihre Mutter, gegen Aegisth, verbal aber auch gegen ihre Geschwister und gegen sich selbst, wenn sie sich mit einer Gartenschere verletzt, und gegen ihre Puppe, die sie grausam zurichtet. Sie tritt mit einem Bild auf, das Vater (Agamemnon) und Tochter in glücklichen Kleinkindzeiten zeigt. Das wirkt schlüssig – wenn Elektra dann am Ende ihres Monologs („und glücklich ist, wer Kinder hat, die um sein hohes Grab so königliche Siegestänze tanzen!“) dann fröhlich über die Bühne hopst, schon deutlich weniger. Vielleicht zeigt es auch die noch kindliche Elektra, die ihren Gefühlen keinen anderen Ausdruck geben kann – was man der Hofmannsthalschen Sprache allerdings kaum abnimmt.
Chrysothemis ist ein paar Jahre älter als sie, trägt ein Kleid und schminkt sich. Wie schon bei Strauss bleibt diese Figur auch in dieser Inszenierung vergleichsweise am blassesten. Sie will ein Leben führen, das wir als „normal“ bezeichnen würden: „Kinder will ich haben, bevor mein Leib verwelkt. […] Ich bin ein Weib und will ein Weiberschicksal“. Das ist natürlich weniger dramatisch als die blutrünstigen Rachevisionen der Elektra.

Das Zusammentreffen Elektras mit ihrer Mutter Klytämnestra ist sicherlich ein Höhepunkt des Abends. Zu Klytämnestras Auftritt fallen gehäutete Opfertiere vom Bühnenhimmel; die Vertraute und die Schleppträgerin vertäuen ihre Herrin dann mit den Tierkadavern, so daß Klytämnestra am Tropf der Tiere hängt, was die Phrase „und folg' ich dir nicht und schlachte, schlachte, schlachte Opfer und Opfer“ gut illustriert. Optisch sind diese Requisiten recht dominant und schränken auch die Bewegungsfreiheit Klytämnestras erheblich ein. Mutter und Tochter halten hier Distanz, auch wenn Elektra ihr Sätze wie „sausend fällt das Beil, und ich steh' da und seh' dich endlich sterben!“ an den Kopf wirft. Da befällt den Rezensenten etwas Wehmut, der in seiner ersten Elektra erlebte, wie Gwyneth Jones furienhaft ihrer Bühnenmutter Leonie Rysanek buchstäblich an die Gurgel ging.
"Wer schlachtet ein Opfertier im Schlaf?"
Nach dem Beil muß hier nicht gegraben werden, Elektra holt es von der Seite. Es wird viel damit hantiert, nur gibt sie es nicht dem Orest – das leuchtet nicht recht ein, ist die Wiedererkennungsszene mit ihrem Bruder doch eigentlich lang genug. Orest versteckt sich im Kapuzenmantel; daß die Geschwister sich nicht erkennen, ist schon in anderen Inszenierungen meist nicht schlüssig gelöst, so auch hier. Aegisth wird in seinem kurzen Auftritt als schmieriger Lover gezeichnet und dann – anders als die wie vorgesehen außer Sichtweite gemordete Klytämnestra – vor den Augen des Publikums von Orest niedergemacht und umgehend (warum eigentlich?) von der Bühne geschleift. Die Regie läßt Elektra danach fröhlich umherhüpfen und Konfetti regnen. Das zeigt wohl die Perspektive Elektras, wirkt aber trotzdem etwas übertrieben. Zu Elektras Tanz am Ende fließen 300 Liter Theaterblut von oben die Wände herab; auch hier ist der Zeitpunkt nicht ganz einleuchtend. Der Schluß (Bläserakkorde in es-Moll im Piano, dazu die Partituranweisung „Elektra fällt zusammen“ – „Elektra liegt still“) wird erheblich beeinträchtigt, wenn Elektra zum Piano fröhlich in die Hände klatscht. Dreizehnjährige Mädchen können manchmal nerven.
Manche Details wirken wie eine Erklärung für die Entwicklung, daß „Regietheater“ bei manchen als Schimpfwort gilt – muß Elektra wirklich zu einem Piano des Orchesters (nach „nun denn – allein!“) lautstark mit einer Kettensäge hantieren? Muß man wirklich das Ende jeder Oper umkehren? Hier etwa schneidet sich Orest die Pulsadern auf. Das verleiht den „Orest! Orest!“-Rufen der Chrysothemis, den letzten gesungenen Worten der Oper, etwas unmittelbar Beklemmendes, aber warum wendet sich das Orchester in diesem Moment dann zu einem C-Dur im Fortissimo?

Dargestellt wird der Backfisch Elektra von Rachel Nicholls. Sie wirkt auf der Bühne glaubhaft sehr jung, ist aber auch kein hochdramatischer Sopran. Die Inszenierung hilft ihr, aber die manchmal wüste Dramatik der Partitur kann sie nicht zur Gänze verkörpern. Wenn Elektra tatsächlich als so jung aufgefaßt wird wie hier, sind manche ihrer Handlungen in der Tat glaubhafter als bei Sängerinnen, die schon seit vielen Jahren in Bayreuth singen. Wie Stimme und Regie teilweise sehr gut zusammenfanden, zeigt sich, als Elektra in der Annahme, Orest sei tot, Chrysothemis überzeugen möchte, den Rachemord an der Mutter gemeinsam mit ihr zu begehen. Chrysothemis entwindet sich mit den Worten „Ich kann nicht“ ihrer Schwester und läuft davon, Elektra schleudert ihr „Sei verflucht“ hinterher – zwei lange halbe Noten auf dem hohen B. Birgit Nilsson, Hildegard Behrens und andere haben viel Aggression in diese Phrase gelegt, Rachel Nicholls läuft Chrysothemis noch halb hinterher, bricht in der hinteren Bühnenmitte zusammen und weint diesen Satz eher in sich hinein.
Chrysothemis (Pauliina Linnosaari) sang wenig textverständlich, lieferte aber eine solide Leistung. Klytämnestra (Ursula Hesse von den Steinen) gestaltete ihre Rolle mit viel gut verständlichem Sprechgesang, wie er in der Partie auch angelegt ist. Manchmal waren ihre Worte fast geflüstert. In dieser Lesart ist Klytämnestra keine ältere oder gar alte Frau, sondern vielleicht vierzig Jahre alt und daher durchaus energisch. Man muß diese Partie nicht mit einer Hochdramatischen besetzen, die aus dem Brünnhilden-Fach herausgewachsen ist. Michael Kupfer-Radecky als Orest, Rolf Romei als Aegisth sowie die Mägde und die anderen kleinen Rollen brachten gute Ensembleleistungen.

Erik Nielsen, Musikdirektor am Theater Basel, dirigierte ein sehr großes Orchester, das nur in den Streichern etwas verschlankt war. Die vielen Musiker fanden im Graben kaum Platz, so daß Schlagwerk und schweres Blech halb unter der Bühne saßen. Der Klang war von Bayreuth dennoch weit entfernt. Nielsen hat sich, sicherlich auch mit Rücksicht auf das Basler Sängerensemble, gegen eine musikalische Gewaltorgie entschieden. Packend war das Ineinandergreifen von Klytämnestras Sprechgesang und dem Pianissimo des Riesenorchesters im Monolog „Was ist denn ein Hauch?“, der den Alpdruck der Mutter fühlbar machte. Das erste echte Fortissimo galt erstaunlicherweise erst dem Pfleger des Orest („Seid ihr von Sinnen, daß ihr euren Mund nicht bändigt“), dessen Auftritt mit starken Pauken eingeleitet wird. Einzelne Passagen wurden fast ins Endlose zerdehnt (Elektras Anruf an Agamemnon in ihrem Anfangsmonolog zu den gehaltenen Bläserakkorden in b-Moll), auch Orests „Ich muß hier warten“ – selbst wenn die Partitur hier „langsam und feierlich, noch etwas langsamer als vorher“ vorschreibt. Nach dem zweiten Schrei Klytämnestras brüllte das Orchester auf, und in der Folge wurden Tempo und Dynamik sehr angezogen, so daß sich die Klänge fast überschlugen, mitunter zu Lasten der Präzision im Detail. So wurde die Perspektive der Elektra wohl auch im Graben gewahrt. Nielsen gilt als ein Spezialist für dieses Repertoire, was an verschiedenen Passagen auch deutlich wurde; die Gesamtlesart vermochte noch nicht restlos zu überzeugen. Der gewaltige Schlussakkord (es-Moll – C-Dur) allerdings gelang sehr präzise und lähmte das Publikum während mehrerer Sekunden, bevor es in freundlichen, sich steigernden Applaus ausbrach.

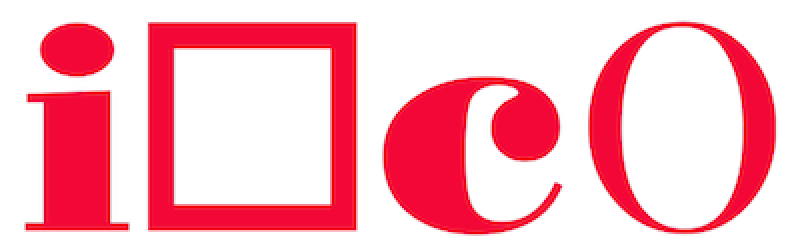

Kommentare ()